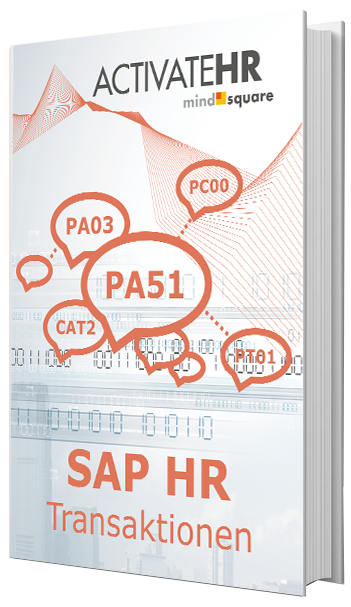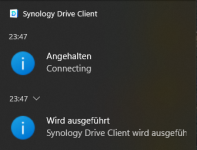Parlamentarischer Rat
Bonn 1948/49
Anlage
zum stenographischen Bericht der
9. Sitzung am 6. Mai 1949
Schriftlicher Bericht
des Abgeordneten Dr. von Brentano
über den Abschnitt
XI. Übergangs- und Schlußbestimmungen
Die im Herrenchiemseer Entwurf vorgesehenen „Uebergangs- und Schlußbestimmungen“ waren einerseits verhältnismäßig knapp gehalten, indem sie, neben Vorschriften über das Inkraft- bezw. Außerkrafttreten des Grundgesetzes in erster Linie das Verhältnis des bisherigen Rechts zu dem durch das Grundgesetz geschaffenen Rechtszustand im Auge hatten und dabei das Problem der Fortgeltung der beim Inkrafttreten des Grundgesetzes vorhandenen „Rechtsmasse“ zu lösen suchten. Gleichwohl bekunden sie andererseits insofern eine gewisse Tendenz zur Detaillierung, als sie z. B. eine Uebertragung der Befugnis zur Ernennung der Bundesbediensteten vom Bundespräsidenten auf andere Stellen sowie eine Vereidigung aller öffentlichen Bediensteten auf das Grundgesetz vorsahen. Was die Delegation des Ernennungsrechts angeht, so erschien es von Anfang an richtiger -mit Rücksicht auf den inneren Zusammenhang mit dem Ernennungsrecht selbst -, sie ggf. im Rahmen der Normierung der für den Bundespräsidenten vorgesehenen Kompetenzen mitzuregeln. Die Aufnahme einer besonderen Vorschrift über die Vereidigung -nach dem Vorbild der Weimarer Verfassung bezüglich der Beamten in deren Artikel 176 -wurde für überflüssig erachtet, gemäß einer Anregung des Redaktionsausschusses, der auf den problematischen Wert solcher Eide hingewiesen und bemerkt hatte, erforderlichenfalls könne die Vereidigung bundesgesetzlich geregelt werden. Eine „Vereidigung“ von Angestellten war zudem im allgemeinen bisher nicht üblich.
Unausweichlich aber sah sich der Bonner Verfassungsgesetzgeber vor eine Reihe von Problemen gestellt, die gebieterisch eine Lösung erheischten und deren zweckdienlichste Regelung der Natur der Sache nach in Gestalt der Schaffung entsprechender Uebergangs- bzw. Schlußbestimmungen erfolgen konnte. Im Grunde handelte es sich vor allem um eine Anzahl von Problemkreisen, die zwar teilweise keine eigentliche innere Verbindung miteinander aufwiesen, aber sich jeweils wieder aus mehr oder weniger zahlreichen Einzelproblemen zusammensetzten.
Diese Problemkreise waren:
– Die Fortgeltung bisherigen Rechts,
– Das rechtliche Schicksal bestimmter bisheriger gesetzgebender und koordinierender Körperschaften (z. B. Länderrat Stuttgart, Wirtschaftsrat u. a.),
– Fragen der Rechts- bezw. Vermögensnachfolge,
– Besondere Gestaltung der rechtlichen Position früherer bezw. jetziger Angehöriger des öffentlichen Dienstes,
– Grundgesetzliche Legaldefinitionen,
– Schaffung der Voraussetzung für das Effektivwerden der ersten Bundesorgane,
– Wirksamwerden des Grundgesetzes,
– Erleichterte Revision und Außerkrafttreten des Grundgesetzes.
Darüber hinaus ergab sich, und zwar mit Fortschreiten der Verfassungsarbeiten in gesteigertem Maße, die Notwendigkeit, in den Uebergangs- und Schlußbestimmungen auch bestimmte Einzelfragen zu regeln, insbesondere solche, deren besondere Dringlichkeit in der Tatsache des verlorenen Krieges bzw. des staatlichen Zusammenbruchs im Jahre 1945 und den daraus resultierenden Folgen(einschließlich gewisser Forderungen der Besatzungsmächte) wurzelte. Dabei handelte es sich um:
– Die Tragung der Aufwendungen für Besatzungskosten durch den Bund, Beschleunigte Regelung von Flüchtlings- und Vertriebenenangelegenheiten,
– Das Problem des Südwest-Staates,
– Die Beschränkung der Wählbarkeit von Beamten usw.,
– Strafbarkeit hochverräterischer Handlungen.
Schließlich mußte noch eine Sonderbestimmung hinsichtlich evtl. Aenderungen des süddeutschen Notariatwesens aufgenommen werden.
Insgesamt gesehen hat sich die Voraussage des Abg. Dr. Katz erfüllt, der bereits in der 18. Sitzung des Organisationsausschusses (27. Oktober 1948) darauf hingewiesen hatte, es werde zu guter Letzt ein ausgesprochenes „Sammelsurium“ von Uebergangs- und Schlußbestimmungen herauskommen.
Fortgeltung bisherigen Rechts:
1. Artikel 123:
a) Absatz 1 (die grundlegende Vorschrift):
Diese Bestimmung beruht in ihrer Fassung auf einem Vorschlag des Allgemeinen Redaktionsausschusses. Die gewählte Formulierung war aus einem doppelten Grunde derjenigen des Herrenchiemseer Entwurfes vorzuziehen: einmal, weil hier allgemein von „Recht“ die Rede ist, worunter alles Recht zu verstehen ist, nicht nur Gesetzesrecht, sondern insbesondere auch Gewohnheitsrecht (in dem Herrenchiemseer Entwurf waren dagegen nur Gesetze und Verordnungen genannt); und zum zweiten deshalb, weil es nicht lediglich auf das Inkrafttreten des Grundgesetzes, sondern darüber hinaus in erster Linie auf den Zusammentritt des Bundestages (Artikel 122) ankommt. Der Vorschlag des Redaktionsausschusses wurde vom Organisationsausschuß übernommen und sowohl vom Hauptausschuß wie vom Plenum in allen folgenden Lesungen gutgeheißen.
Weitergeltendes Recht kann zunächst sein das vor dem 8. Mai 1945, also ohne fremde Einwirkung, entstandene Reichs- und Landesrecht.
Zu untersuchen ist, ob auch das nach diesem Stichtermin entstandene Recht von dem Art. 123 Abs. 1 erfaßt wird, soweit dieses Recht, unter Mitwirkung der Besatzungsmächte zustande gekommen ist. Der Bereich des von den Besatzungsmächten unmittelbar gesetzten Rechts soll hier dahingestellt bleiben.
Wenn demgemäß von den insoweit sich aufwerfenden Rechtsfragen abgesehen wird, so ergibt sich:
Alles übrige, nach dem 8. Mai 1945 entstandene Recht ist zwar von deutschen Stellen gesetzt worden, konnte jedoch nur unter Mitwirkung der Besatzungsmächte zustande kommen. Auch hier wieder läßt sich die Frage aufwerfen, ob bezw. wann es sich in solchen Fällen um rein innerdeutsches bezw. oktroyiertes Recht im Sinne der obenerwähnten Unterscheidung handelt. Die hier in Frage kommenden Fälle sind z. B. von Höpfner (MDR 1949, S. 198 f.) im einzelnen untersucht worden. In sehr subtiler Untersuchung hat er eine Skala aufgestellt, an Hand deren die einschlägigen Gesetzgebungsmöglichkeiten in bestimmte Kategorien eingruppiert werden. Dabei wird jeweils zu klären versucht, ob diese Kategorien zur deutschen Gesetzgebung oder zu derjenigen der Militärregierung gehören. Sachlich dürfte es nicht zutreffen, wenn H. bei der Gesetzgebung der Zentralämter der britischen Zone nur ein „Einspruchsrecht“ der Besatzungsmacht annimmt; tatsächlich sind die jeweiligen Verordnungen (nicht „Gesetze“) mit „Zustimmung“ der Militärregierung ergangen: vgl. z. B. die Rechtsanwaltsordnung für die britische Zone vom 10.3.1949, Verordnungsbl. Nr. 15, S. 18 f. Die Zurechnung der einzelnen Kategorien zur deutschen bzw. alliierten Gesetzgebung kann nach H. sich in einzelnen Fällen verschieden gestalten, je nachdem, ob man bei der Betrachtung den Schwerpunkt auf die Zuständigkeitsgestaltung oder auf die Gestaltung des Genehmigungsrechtes legt. Zusammenfassend kommt H. zu dem Ergebms, daß rechtlich von den insgesamt denkbaren 7 Fällen 5 der Gesetzgebung der Militärregierung und nur 2 der deutschen Gesetzgebung zuzurechnen seien: „Poltisch gehören umgekehrt nur die beiden ersten Formen zur Gesetzgebung der Militärregierung, die weiteren dagegen zur deutschen Gesetzgebung“. Diese beiden ersten Fälle sind aber solche unmittelbarer Rechtssetzung, so daß sie ohnehin an dieser Stelle ausscheiden. Dagegen würden hierher u. a. gehören Gesetze und Verordnungen der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes. Sie beruhten nicht nur auf einer Ermächtigung durch die Proklamation Nr. 5 der amerikanischen bzw. der Verordnung Nr. 88 der britischen Militärregierung, sondern bedurften vor ihrer Verkündigung jeweils der Genehmigung des Bipartite Control Boards. Die Gesetze des Länderrats in Stuttgart hatten keinerlei Grundlage im deutschen Verfassungsrecht, sondern beruhten auf Artikel III der Proklamation Nr. 4; auch sie durften erst nach Genehmigung verkündet werden. Schließlich sind von den deutschen Gesetzgebern, vor allem in der ersten Zeit nach dem Zusammenbruch, „Gesetze“ auf Befehl der Militärregierungen erlassen worden, so das hessische Beamtengesetz vom 12.11.1946.
Die von Höpfner zum Zweck der Gewinnung eines Unterscheidungsmerkmals gebrauchte Kennzeichnung „politisch“ ist allerdings mißverständlich. Dieses Wort ist begrifflich keine Antithese gegenüber dem Wort „rechtlich“, jedenfalls nicht in dem von H. in Wahrheit gemeinten Sinne. Was er wirklich meint, ist nämlich „formellrechtlich“ im Gegensatz zu „materiellrechtlich“. Als richtiger muß deshalb die vom Badischen Staatsgerichtshof (vgl. SJZ. 1949, S. 220) gemachte Unterscheidung gelten, der eine auf Befehl der Besatzungsmacht erlassene Verordnung dahin charakterisiert, daß sie ihrer „äußeren Form“ nach badisches Recht, ihrem materiellen Gehalt nach aber Recht der Militärregierung sei.
Es kommt jedoch nunmehr, nach Inkrafttreten des Grundgesetzes, gar nicht mehr darauf an, ob der Inhalt einer Rechtsvorschrift seinerzeit ausschließlich von deutschen Stellen oder, sei es ganz oder teilweise, durch die Besatzungsmacht bestimmt worden ist. Insoweit läuft die Trennungslinie nicht mehr zwischen rein innerdeutschem Recht auf der einen und oktroyiertem Recht auf der anderen Seite. Entscheidend ist vielmehr ausschließlich die formellrechtliche Gestaltung. Dieser Schluß ergibt sich eindeutig aus Ziffer 7 des Besatzungsstatuts. Hier wird angeordnet, daß inkraftbleiben „Gesetze der Besatzungsbehörden“: Legislation of the Occupation Authorities . . . shall remain in force. Diese „legislation“ kann nur bedeuten das Ergebnis gesetzgeberischer Tätigkeit von Besatzungsorganen selbst. In diesem einen Falle hat sich allerdings, wie bereits ausgeführt, die Intention des Verfassungsgesetzgebers nicht realisieren lassen, die dahin ging, das gesamte Recht von innerdeutscher Geltung als seiner und künftig der Disposition der deutschen Gesetzgebungsorgane unterworfen anzusehen. Es handelt sich aber um einen Ausnahmefall. Das gesamte übrige Recht unterliegt dieser Disposition, d. h. in vollem Umfang auch dasjenige Recht, das seinerzeit irgendwie unter „Mitwirkung“ oder auf Befehl oder im Auftrag einer Besatzungsmacht entstanden ist, sofern es nur formell von einer deutschen, dafür zuständigen Stelle erlassen worden ist.
Daraus ergibt sich: bei Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz gilt dieses Recht -und zwar bereits jetzt -in jedem Falle als deutsches Recht weiter, auch wenn es erst durch Herstellung der deutschen Dispositionsbefugnis oder im Wege einer „Transformation“ zu ausschließlich „innerdeutschem“ Recht geworden sein sollte. Bei Unvereinbarkeit mit dem Grundgesetz gilt dieses Recht im Hinblick auf den Widerspruch mit dem Grundgesetz nicht weiter; soweit man bisher derartiges Recht nach Ursprung und Rechtscharakter als außerdeutsches Recht angesehen haben sollte, würde zudem dieser Widerspruch die erforderliche Transformation ausgeschlossen haben. Auf dieses Recht finden deshalb ggf. auch die Art. 124 und 125 Anwendung.
In keinem Falle gilt solches Recht (arg. aus Ziff. 7 des Besatzungsstatuts) als außerdeutsches Recht weiter.
Abgesehen von dem vorstehend behandelten Fall -Recht, das unter Mitwirkung der Besatzungsmächte gesetzt worden ist -kann es sich bei dem im Rahmen des Artikels 123 weitergeltenden Recht, unabhängig von seiner Erscheinungsform -formelles Gesetz, Rechtsverordnung oder Gewohnheitsrecht -im einzelnen handeln um:
früheres Reichsrecht,
früheres Landesrecht,
neues Landesrecht,
bizonales Recht,
zonales Recht.
b) Absatz 2 (internationale Verträge):
Den Ausgangspunkt für diese Bestimmung bildete ein gemeinsamer Antrag der Fraktionen der CDU/ CSU, des Zentrums und der deutschen Partei vom 29.11.1948, der das Verhältnis zwischen Staat und Kirchen in seiner Gesamtheit regeln wollte und unter Ziffer 7 besagte: „die am 1. Januar 1945 bestehenden Verträge mit den Kirchen bleiben in Kraft, bis sie durch neue, von den Ländern abzuschließende Vereinbarungen abgelöst sind“. In der ersten Lesung des Hauptausschusses (22. Sitzung) verfiel indes der Antrag, in dem auf Vorschlag des Abg. Dr. Seebohm (DP) mit Zustimmung des Abg. Dr. Süsterhenn (CDU) das Datum in „8. Mai 1945“ abgeändert und das Wort „Vereinbarungen“ durch „Verträge“ ersetzt worden war, mit den elf Stimmen der SPD, FDP und KPD gegen die zehn Stimmen der übrigen Parteien der Ablehnung. Das gleiche Schicksal, mit dem gleichen Stimmenverhältnis, erlitt ein zweiter Antrag des Abg. Dr. Süsterhenn (CDU), soweit er unter Ziff. 2 wiederum lautete: „Alle am 8. Mai 1945 bestehenden Verträge mit den Kirchen bleiben in Kraft, bis sie durch neue, von den Ländern abzuschließende Verträge ersetzt werden“. (Ziffer 1), die bestimmte Artikel der Weimarer Verfassung aufrecht erhalten wollte, fand Annahme). Dagegen wurde ein Antrag des Abg. Dr. Heuß (FDP): „Die am 8. Mai 1945 bestehenden Verträge zwischen den Ländern und den Kirchen bleiben in Kraft, bis ….“ mit elf gegen acht Stimmen angenommen. Gegenüber dem Antrag des Abg. Dr. Heuß (FDP) hatte zwar der Abg. Dr. Süsterhenn (CDU) darauf hingewiesen, in der Völkerrechtswissenschaft sei allgemein anerkannt, daß auch das zwischen Hitler und dem Heiligen Stuhl am 20. Juli / 12. September 1933 abgeschlossene Reichskonkordat noch geltendes Recht sei; ebenfalls träten sowohl der eine Vertragspartner, die Kurie, wie auch der Rechtsnachfolger des anderen, der Alliierte Kontrollrat, für die Fortgeltung ein. Der Antragsteller (Dr. Heuß) vertrat jedoch den Standpunkt, das Reichskonkordat sei „dolos“ zustande gekommen.
Für die zweite Lesung lag dem Hauptausschuß eine Fassung des Organisationsausschusses vor, die besagte: „Die am 8. Mai 1945 bestehenden Verträge zwischen den Ländern und den Kirchen bleiben in Kraft, bis die Länder neue Verträge abschließen“; Hiermit sollte zum Ausdruck gebracht werden, daß keine Verpflichtung der Länder zum Abschluß neuer Verträge bestehe. In zweiter Lesung befaßte sich der Hauptausschuß in zwei Sitzungen (39. Und 46. Sitzung) mit dieser Materie. In der 39. Sitzung wurde inbesondere von dem Abg. Zinn (SPD) geltend gemacht, daß die Länderkonkordate als quasi-völkerrechtliche Verträge gegenstandslos geworden seien, da die Länder im Jahre 1934 ihre Eigenschaft als Völkerrechtssubjekte verloren hätten, und daß auch ihre innerstaatliche Weitergeltung zweifelhaft sei. Der Abg. Dr. Höpker.Aschoff (FDP) betonte, daß der Bund überhaupt nicht in der Lage sei, Verträge anzuerkennen, die er angesichts der dem Grundgesetz zugrundeliegenden Kompetenz-Verteilung selbst gar nicht abschließen könne, da er im Bereich der Kirchen-Angelegenheiten weder eine Gesetzgebungs- noch eine Verwaltungszuständigkeit besitze. Mit dieser Vorschrift werde deshalb in die Zuständigkeit der Länder eingegriffen. Demgegenüber konnte der Abg. Dr. Süsterhenn (CDU) darauf hinweisen, daß gerade angesichts der vielfachen Zweifelsfragen eine eindeutige materielle Festlegung des Rechtszustandes im Verhältnis Staat-Kirche um so dringlicher sei. Auch in der 46. Sitzung des Hauptausschusses wurden die sich gegenüberstehenden, bereits in ihrem Ausgangspunkt gegensätzlichen Auffassungen wieder offenbar mit dem Ergebnis, daß der ganze Fragenkomplex schließlich für die dritte Lesung zurückgestellt wurde.
Inzwischen hatte die Situation sich dadurch weiter versteift, daß über die Frage der Länder-Konkordate hinaus von der einen Seite wiederum die Anerkennung der Fortgeltung des Reichskonkordates ebenso nachdrücklich gefordert, wie sie von der anderen Seite unter Berufung auf Gründe allgemein politischer und juristischer Art entschieden abgelehnt wurde. Nach langwierigen Verhandlungen im sog. Fünfer-Ausschuß wurde dann ein Kompromiß in Gestalt einer Formulierung gefunden, die sowohl in ihrem Wortlaut ganz allgemein gehalten ist, wie auch in der Sache selbst überhaupt keine Entscheidung, weder in der einen noch in der anderen Richtung, bedeutete. In dieser Fassung wurde die Bestimmung vom Hauptausschuß in dritter und vierter Lesung (51. Sitzung und 57. Sitzung) -unter Ablehnung eines SPD-Streichungsantrages -sowie anschließend vom Plenum in zweiter und dritter Lesung angenommen.
Nicht umfaßt werden von der Bestimmung lediglich die Verträge privatrechtlicher Art, die das Reich als Fiskus geschlossen hat. Ihre inhaltliche Tragweite ist aufgrund der ihr vorausgegangenen interfraktionellen Besprechungen in der zweiten Lesung des Plenums von dem Berichterstatter Dr. von Brentano (CDU) wie folgt gekennzeichnet worden: „. . . Der Parlamentarische Rat konnte es nicht als im Rahmen seiner Zuständigkeit liegend erachten, zu der Frage der völkerrechtlichen und innerstaatlichen Weitergeltung der vom Deutsehen Reich abgeschlossenen internationalen Verträge, so auch des Reichskonkordats von 1933, Stellung zu nehmen. Die Gültigkeit solcher Verträge ist, wie aus Artikel 124 -jetzt Artikel 123 -hervorgeht, nach den allgemein gültigen Rechtsgrundsätzen zu beurteilen. In Artikel 124 wird darüber nicht entschieden.“
2. Artikel 124 und Artikel 125 (Fortgeltung als Bundesrecht im Bereich:
a) der ausschließlichen Gesetzgebung des Bundes (124)
b) der konkurrierenden Gesetzgebung des Bundes (125):
Der Organisationsausschuß übernahm in seiner 18. Sitzung die im Artikel 139 des Herrenchiemseer Entwurfes (2. Alternative) vorgeschlagene Regelung, die lautete:
1. Gesetze und Verordnungen, die Gegenstände des Artikels 35 oder 36 (diese regelten die ausschließliche bezw. die konkurrierende Gesetzgebung im Herrenchiemseer Entwurf) betreffen, gelten mit Ausnahme der Bereiche, für die der Bund nur Grundsätze aufstellen kann, als Bundesrecht, sonstiges Recht als Landesrecht fort.
2. a. Jedoch gelten Gesetze und Verordnungen, die unter Artikel 36 des Grundgesetzes fallen und sich auf ein Land beschränken, als Landesrecht fort, es sei denn, daß es sich um früheres Reichsrecht handelt, das im ganzen Reichsgebiet gegolten hat und nach dem 8. Mai 1945 durch Landesgesetz abgeändert worden ist.
Demgegenüber wurde vom Allgemeinen Redaktionsausschuß bereits unter dem 18.11.1948 folgende Fassung vorgeschlagen:
Recht, das Gegenstände der ausschließlichen Gesetzgebung des Bundes betrifft, wird innerhalb seines Geltungsbereiches Bundesrecht.
b. Recht, das Gegenstände der Vorranggesetzgebung des Bundes betrifft, wird innerhalb seines Geltungsbereiches und im Rahmen des Artikels 36 Bundesrecht,
(1) soweit es innerhalb einer oder mehrerer Besatzungszonen einheitlich gilt,
(2) soweit es sich um Recht handelt, durch das nach dem 8. Mai 1945 früheres Reichsrecht abgeändert worden ist.
Diese Formulierung wurde gebilligt vom Organisationsausschuß in seiner 27. Sitzung, sowie vom Hauptausschuß in erster Lesung (20. Sitzung), zweiter (39. Sitzung) und dritter Lesung (51. Sitzung). In der vierten Lesung des Hauptausschusses (57. Sitzung) erhielt die die konkurrierende Gesetzgebung betreffende Vorschrift eine neue verkürzte Fassung, die nach Billigung durch das Plenum in den endgültigen Gesetzestext übernommen worden ist.
Auf den Sachgebieten der ausschließlichen Gesetzgebung wird dabei das gesamte Recht, unabhängig von seiner Rechtsquelle, seiner Erscheinungsform und seinem Geltungsbereich zu Bundesrecht. Infolgedessen wird hier u. U. aus Landesrecht oder partiellem Reichsrecht partielles Bundesrecht entstehen. Schwierigkeiten können sich ergeben, wenn eine fortgeltende reichsrechtliche Regelung Sachgebiete betrifft, die z. T. zur ausschließlichen, zum andern zur konkurrierenden Gesetzgebung gehören oder der Landesgesetzgebung vorbehalten sind. So ist die Regelung der Verwaltung der den Gemeindeverbänden und Gemeinden zufließenden Steuern Angelegenheit der Landesgesetzgebung. Es wird zu prüfen sein, ob die diesbezüglichen Vorschriften des bisherigen Rechts -etwa der- Reichsabgabenordnung -, soweit sie überhaupt weitergelten, nunmehr nicht z. T. als Bundesrecht, z. T. als Landesrecht anzuwenden sind.
Zwar ist auf dem Gebiet der ausschließlichen Gesetzgebung den Ländern das Recht zur Gesetzgebung ohnehin von vornherein, d. h. vom Augenblick des Inkrafttretens des Grundgesetzes bzw. vom Zusammentritt des Bundestages an entzogen. Doch dient es der Klarstellung, wenn aufgrund dessen der Artikel 124 -eine entsprechende Vorschrift fehlte in der Weimarer Verfassung -die folgerichtige Feststellung trifft, daß das Recht, das Gegenstände der ausschließlichen Gesetzgebung betrifft, schlechthin Bundesrecht wird.
Auf den Gebieten der konkurrierenden Gesetzgebung hätten dagegen die Länder ohne eine besondere diesbezügliche Uebergangsbestimmung von ihrer Gesetzgebungsbefugnis Gebrauch machen können, solange nicht der Bund selbst unter Bejahung der Voraussetzungen des Artikels 72 Absatz 2 GG seine Gesetzgebungskompetenz ausübte. Es hätte also die Möglichkeit bestanden, durch Landesgesetz z. B. das Bürgerliche oder das Strafrecht auch künftig noch abzuändern. Hier, wenigstens in einem bestimmten Umfange, einen Riegel vorzuschieben, ist Sinn und Zweck des Artikels 125 GG.
Soweit es sich um diesen Artikel 125 handelt, ist der Bereich des Bundesrechts teils enger und teils weiter gezogen als nach dem Herrenchiemseer Entwurf
Enger zunächst insofern, als, im Falle der Ziffer 1, nicht mehr schlechthin alles die konkurrierende Gesetzgebung betreffende Recht, soweit es in mehr als einem Lande gilt, Bundesrecht wird, sondern nur bei einheitlicher Geltung in mindestens einer Besatzungszone. Das gemäß Ziffer 1 fortgeltende Recht kann sein einerseits früheres Reichsrecht -allgemeines oder solches mit partiellem, aber mindestens den Bereich einer Zone umfassenden Geltungsbereich (letzteres wohl nur in Ausnahmefällen) -; andererseits aber nach dem 8. Mai 1945 bis zum Zusammentritt des Bundestages neugesetztes Recht.
Bei dem neugesetzten Recht wiederum -der Bereich des von den Besatzungsmächten unmittelbar gesetzten Rechts, d. h. Kontrollratsrecht, Zonenmilitärregierungsrecht und Recht der einzelnen Militärregierungen, soll auch hier außer Betracht bleiben -kann es sich, wie vom Allgemeinen Redaktionsausschuß ausdrücklich klargestellt wurde, im einzelnen handeln um:
a. delegiertes Zonenmilitärregierungsrecht
b. bizonales Recht
c. zonales Recht
d. von den Ländern einer Zone „einheitlich geregeltes“ Recht.
Als besonders wichtig kommt in diesem Zusammenhang in Betracht das Recht der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes. Dazu gehört das gesamte Recht, das durch Organe der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes gesetzt worden ist: Gesetze und Verordnungen des Wirtschaftsrates mit den auf Grund von Ermächtigungen ergangenen Aus- und Durchführungsverordnungen der Direktoren. Erwähnt seien: das Bewirtschaftungsnotgesetz, das Wirtschaftsstrafgesetz, das Tarifvertragsgesetz, das Wertpapierbereinigungsgesetz.
Hierher zählen weiter die sogn. zoneneinheitlichen Gesetze der amerikanischen Besatzungszone, und zwar sowohl Gesetze, die vom bzw. im Süddeutschen Länderrat in Stuttgart „beschlossen“ und nach Genehmigung durch die Militärregierung von den einzelnen Ministerpräsidenten „erlassen“ bzw. „verkündet“ worden sind; dazu aber auch solche Gesetze, die zwar zunächst in den einzelnen Ländern ergangen, jedoch nachträglich als zoneneinheitlich erklärt worden sind. Als Beispiele seien angeführt: Befreiungsgesetz, Rechtsmittelgesetz, Vertragshilfegesetz, Gesetz zur Ahndung nationalsozialistischer Straftaten, Gesetz zur Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts in der Strafrechtspflege und Gesetz über die Abänderung der Strafrechtspflegeordnung 1946, das Gesetz zur Abänderung des GVG 1947, das Gesetz über Heilung von Formmängeln bei Eheschließungen 1948. Soweit eines dieser Gesetze für den Bereich Bremens nicht gilt, dürfte durch diesen Umstand die Zoneneinheitlichkeit nicht beeinträchtigt sein.
Erwähnt seien weiter die in der britischen Zone zoneneinheitlich erlassenen Verordnungen, z. B. diejenigen, die auf Grund der MRVO 41 vom Zentraljustizamt oder auf Grund der MRVO 62 vom Zentralamt für Wirtschaft erlassen worden sind.
Es fragt sich, ob dazu auch gehören die zwar nicht zoneneinheitlichen, sondern lediglich „zonenangeglichenen“ Gesetze der amerikanischen Zone, also diejenigen Gesetze, die zwar auf „Vorschlägen“ bzw. „Empfehlungen“ des Länderrats beruhen, jedoch von den einzelnen Länderparlamenten beschlossen worden sind. Grundsätzlich wird man zwar sagen müssen, daß „einheitliche“ Geltung bei Rechtsvorschriften nur gegeben ist, wenn die Geltung aus einer einzigen Rechtsquelle fließt. Gleichwohl läßt es sich rechtfertigen von ihr auch dann zu sprechen, wenn derartige zonenangeglichenen Gesetze bei weitgehender Uebereinstimmung im Wortlaut keine grundlegenden sachlichen Unterschiede aufweisen. Diese Gesetze bilden dann die Kategorie des „von den Ländern einheitlich geregelten Rechtes“. Wenn somit an den Begriff der Zoneneinheitlichkeit kein allzuenger Masstab angelegt werden darf, so dürfte sie auch dort zu bejahen sein, wo zwar lediglich in den „grundlegenden“ Vorschriften Uebereinstimmung besteht, die übrigen Bestimmungen aber zufolge der besonderen Bedürfnisse und Verhältnisse in den einzelnen Ländern eine jeweils verschiedene Gestaltung erfahren haben.
Jedoch fällt unter die Ziffer 1 nicht z. B. das Verwaltungsgerichtsgesetz der Länder der amerikanischen Zone, trotz weitgehender Uebereinstimmung im Wortlaut und in den „grundlegenden“ Bestimmungen. Entscheidend ist bezüglich dieses Gesetzes die Tatsache, daß es nicht vom Süddeutschen Länderrat, wie andere bereits früher erlassene Gesetze, am 9.9.1947 für zoneneinheitlich erklärt worden ist. Bereits zu diesem Zeitpunkt wurde auch für dieses Gebiet die Fortdauer möglichster Rechtsgleichheit innerhalb der amerikanischen Zone ausdrücklich noch einmal für erwünscht erklärt. Bisher ist denn auch keine Durchbrechung der Rechtseinheit durch isoliertes Vorgehen eines Landes bekannt geworden. Immerhin ist die Gefahr, daß die bereits errungene und für den Glauben an den Rechtsstaat gerade auch auf diesem Gebiet besonders wichtige Rechtseinheit wieder verloren gehen könnte, bei den Zufälligkeiten der Landesgesetzgebung nicht ganz von der Hand zu weisen. So ist z. B. vor längerer Zeit dem Verfassungsausschuß des Bayerischen Landtages ein Regierungsentwurf zur Vereinfachung der Verwaltungsrechtspflege zugeleitet worden. Dieser Entwurf sieht eine (vorübergehende) Einschränkung der Rechtsmittel (der Berufungemöglichkeit) vor, weshalb der Ausschuß aus grundsätzlichen Bedenken ihm seinerzeit die Zustimmung verweigerte (vgl. Südd. Ztg. v. 19. 7. 47).
Ebensowenig ist das Recht der Verwaltungsgerichtsbarkeit in der französischen Zone als zoneneinheitlich anzusehen: in den Ländern Rheinland-Pfalz und Württemberg-Hohenzollern gilt das bisherige Landesrecht nach dem Stande vom 30.1.1933, in den ehemals preußischen Gebietsteilen also das preußische Landesverwaltungsgesetz; in diesen Ländern gibt es also insoweit bisher nur das Enumerationsprinzip. Dagegen gilt im Lande Südbaden die verwaltungsgerichtliche Generalklausel.
Weiter als im Herrenchiemseer Entwurf ist der Bereich des Bundesrechts zunächst insofern, als, im Falle der Ziffer 2, -sie steht zu Ziffer 1 in einem Alternativ-Verhältnis -das abgeänderte frühere Reichsrecht nicht im ganzen Reichsgebiet gegolten zu haben braucht, wenn auch die frühere gesamtterritoriale und nicht nur partielle Geltung durchaus den Regelfall bilden wird.
Allerdings liegt eine gewisse Ungereimtheit darin, daß früheres, jetzt nicht mindestens den Bereich einer Zone (einheitlich) umfassendes Reichsrecht soweit es unverändert fortgilt -arg. aus dem Wortlaut der Ziffer 1 -Landesrecht, soweit es dagegen abgeändert worden ist -Ziffer 2 -, in der abgeänderten Form Bundesrecht wird. Diese „Ungereimtheit“ läßt sich jedoch nicht dadurch beseitigen, daß man ganz allgemein früheres Reichsrecht auch dann zu Bundesrecht werden läßt, wenn es nur noch in Teilen einer oder mehrerer Zonen oder in keiner Zone mehr einheitlich gilt. Das schließt der Wortlaut des Artikels 125 eindeutig aus, und aus dem Umstand allein, daß Artikel 125 Ziffer 2 jede Aenderung von Reichsrecht zu Bundesrecht werden läßt, ergibt sich keineswegs die zwingende Schlußfolgerung, daß dann erst recht in jedem Falle unverändertes Reichsrecht unabhängig von dem gegenwärtigen Umfang seines Geltungsbereiches zu Bundesrecht werden müsse. Es mag zwar -vielleicht – besonders wünschenswert erscheinen, wenn dasjenige frühere Reichsrecht, das seinerzeit im gesamten Reichsgebiet gegolten hat und nur infolge Abänderungen durch die Länder nach dem 8. Mai 1945 nunmehr eine einheitliche Geltung in mindestens einer Zone nicht mehr besitzt, auch dort Bundesrecht würde, wo es noch unverändert weiter gilt. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, daß auch eine solche „eingeschränkte“ Bundesrechts-Theorie mit dem Wortlaut kaum in Einklang zu bringen wäre, und daß sich auch in der Entstehungsgeschichte keine Stütze für eine derartige Auffassung findet. Nirgendwo ist ein Anhaltspunkt dafür ersichtlich, daß man etwa eine Fortgeltung als Bundesrecht in solchen Fällen als selbstverständlich angesehen hätte.
Hier ist noch auf folgende Fälle hinzuweisen: Zur Zeit des „Dritten Reiches“ ist in gewissen Fällen die Durchführung eines Reichsgesetzes einem Reichsminister übertragen und dabei bestimmt worden, daß „vorläufig“ das Landesrecht in Kraft bleibe, von den Ländern jedoch nur mit Zustimmung des betreffenden Reichsministers geändert oder ergänzt werden dürfe. Dieses seinerzeit „vorläufig“ in Kraft belassene bzw. mit der vorgesehenen Zustimmung geänderte Recht könnte sowohl gemäß Artikel 125 Ziffer 1 wie auf Grund der Ziff. 2 nur dann Bundesrecht werden, wenn es sich um früheres Reichsrecht handeln würde. Das ist indes nicht der Fall. Auch das frühere, mit Zustimmung eines Reichsministers von einem Land gesetzte Recht hörte dadurch nicht auf, Landesrecht zu sein. Behält doch selbst auf den Sachgebieten der ausschließlichen Gesetzggebung des Bundes das gemäß Artikel 71 GG mit bundesgesetzlicher Ermächtigung erlassene Landesrecht seinen Charakter als Landesrecht.
Nicht erforderlich ist, daß, im Falle der Ziffer 2, das frühere Recht nach dem 8. Mai 1945 allgemein abgeändert sein müßte, wie ein Antrag der Abgeordneten Dr. v. Brentano (CDU), Dr. de Chapeaurouge (CDU) und Dr. Laforet (CSU) -Drucksache Nr. 812 -vorsah, der indes in der Hauptausschußsitzung vom 6.5.1949 zurückgezogen wurde: durch das Erfordernis der „allgemeinen“ Abänderung wäre der Tatbestand der Ziffer 2 durch denjenigen der Ziffer 1 absorbiert worden. Die jetzige Regelung bedeutet also, daß unter der Voraussetzung der Ziffer 2 auch jede einzelstaatliche oder nur für Teilgebiete eines Landes erfolgte, bisheriges Reichsrecht abändernde Regelung Bundesrecht wird (Beispiel: die hessische Rechtsanwaltsordnung v. 18.10.1948). Diese Konsequenz sah, wie hervorgehoben, bereits der Herrenchiemseer Entwurf vor. Ebenso hob der Redaktionsausschuß in seiner Stellungnahme vom 18.11.1948 neben der Möglichkeit der Abänderung durch Kontrollratsrecht gerade diejenige „durch einzelne Länder“ besonders hervor.
Eine Erweiterung des Bereiches des Bundesrechts ergibt sich ferner, wenn man annimmt, daß von der Fortgeltung als Bundesrecht nicht mehr in toto diejenigen Bereiche ausgenommen sind, für die der Bund auf Grund des Gesetzgebungskatalogs nunmehr lediglich zum Erlaß von Rahmenvorschriften befugt ist. Diese Tatsache kann sowohl im Falle der Ziffer 1 wie der Ziffer 2 von Bedeutung sein.
Vom Allgemeinen Redaktionsausschuß war für die vierte Lesung im Hauptausschuß die ausdrückliche Einbeziehung dieser Materie sogar in folgender weitgehender Fassung vorgeschlagen worden:
Recht, das Gegenstände betrifft, für die der Bund Rahmenvorschriften erlassen kann, wird………….Bundesrecht.
In den interfraktionellen Besprechungen am 4.Mai 1949 wurde jedoch mit Recht darauf hingewiesen, daß damit praktisch für alle diese Fälle die Bestimmung des Artikels 75 GG gegenstandslos werde. Andererseits wurde aber auch ein Vorschlag des Abg. Dr. v. Mangoldt (CDU), das Recht der Rahmenvorschriften -in Uebereinstimmung mit dem Herrenchiemseer Entwurf -generell zu Landesrecht zu erklären, nicht weiter verfolgt. Auf Grund des von dem Abg. Zinn (SPD) vertretenen SPD-Antrages wurde in der vierten Lesung des Hauptausschusses dann der vom Redaktionsausschuß vorgeschlagene Passus gestrichen.
Für die Beurteilung des nunmehrigen Rechtszustandes dürfte zunächst davon auszugehen sein, daß Artikel 75 rechtssystematisch nur einen Unterfall, wenn auch spezieller Art, innerhalb des Gesamtbereichs der konkurrierenden Gesetzgebung darstellt und das Grundgesetz einen besonderen Begriff der Rahmen- oder Grundsatzgesetzgebung nicht kennt. Gleichwohl könnte das, diese Bereiche regelnde, fortgeltende Recht nur teilweise die Qualität von Bundesrecht haben, im übrigen aber ist es jedenfalls Landesrecht. Mangels einer Sonderregelung in den Uebergangsbestimmungen konnte nämlich dieses Recht Bundesrecht nur in den Grenzen der in Artikel 75 selbst normierten Gesetzgebungskompetenz des Bundes sein. Auf diesen Rechtsgebieten ist aber die Gesetzgebungszuständigkeit des Bundes inhaltlich dadurch beschränkt, daß sie sich eben nur auf den Erlaß von Rahmenvorschriften bezieht. Jede seitherige Rechtsnorm, die mehr als eine „Rahmenvorschrift“ darstellt, würde deshalb zu Bundesrecht nur bis zu der für Rahmenvorschriften zulässigen Grenze, dagegen zu Landesrecht werden, insoweit sie diese Grenze überschreitet. Gerade diesen Sachverhalt sollte die ursprünglich vom Redaktionsausschuß vorgeschlagene Fassung „Bundesrecht nur ,im Rahmen’…..“ unzweideutig zum Ausdruck bringen.
Angesichts einer solchen Rechtslage könnten sich Unzuträglichkeiten vor allem in doppelter Hinsicht ergeben: einmal könnte nunmehr dasselbe Gesetz sowohl Bundesrecht wie Landesrecht umfassen. (Der Vorschlag von Herrenchiemsee, in einem solchen Falle das ganze Gesetz zu Landesrecht zu erklären, ist ebenfalls nicht akzeptiert worden). Zum andern kann es u. U. sehr zweifelhaft sein, welche Begriffselemente den Rechtscharakter einer Rahmenvorschrift inhaltlich im einzelnen bestimmen. Selbst wenn man davon ausgeht, daß das Urteil darüber, ob eine bestimmte Rechtsnorm sich noch in den Schranken der dem Bundesgesetzgeber allein gestatteten Rahmenziehung hält, im allgemeinen (bei Erlaß neuen Rechts) allein diesem Gesetzgeber zusteht -in gleicher Weise, wie nach der Auffassung von Anschütz dem früheren Reichsgesetzgeber im Falle der sogen. Grundsatzgesetzgebung -, würde doch für den Spezialfall, daß es sich um seitheriges Recht handelt, diese Entscheidung gemäß Artikel 126 GG und unter dessen Voraussetzungen vom Bundesverfassungsgericht zu treffen sein.
Die vorerwähnten Schwierigkeiten würden dagegen vermieden, wenn man den Artikel 125 eng auslegen und davon ausgehen würde, daß er sich nur auf Gegenstände der konkurrierenden Gesetzgebung „im engeren Sinne“, nämlich ausschließlich im Sinne des Artikels 74 GG bezieht. (So z. B. Kratzer in der Zeitschr.“Wirtschaftsverwaltung“ Heft 17, Sept. 49). Welche von diesen beiden Auffassungen die richtigere ist, läßt sich auf Grund der Entstehungsgeschichte jedenfalls nicht eindeutig ermitteln. Die Frage muß deshalb hier zunächst offenbleiben.
Das gesamte Recht, das -sei es gemäß Ziffer 1, sei es gemäß Ziffer 2 -Bundesrecht wird, wird es nur innerhalb seines, d. h. des bisherigen Geltungsbereiches. Länder außerhalb dieses Geltungsbereiches sind zu einer landesrechtlichen Regelung des gleichen Gegenstandes noch in der Lage.
Der Artikel 125 erregt bereits jetzt in besonderem Maße die Aufmerksamkeit interessierter Kreise, und zwar unter dem Gesichtswinkel, daß man glaubt, eine schwerwiegende Diskrepanz zwischen dieser Bestimmung und der grundsätzlichen Ausgestaltung der konkurrierenden Gesetzgebung in Artikel 72 feststellen zu müssen. So heißt es in einem Artikel von Dr. Karlheinz Lüders (die Welt vom 23. 7. 49), nach einem Hinweis auf die grundsätzliche Bedeutung der Vorschrift des Art. 72 und die angeblich hier liegenden Schwierigkeiten: „umsomehr überrascht, daß sich jetzt plötzlich herausstellt, daß eine andere entlegene Bestimmung des Bonner Grundgesetzes dieses ganze Problem gegenstandslos macht und von so weitgehender Bedeutung ist, wie man das wohl bisher gar nicht geahnt hat. Artikel 125 erklärt das gesamte frühere Reichsrecht zum Bundesrecht, soweit es eine Materie der jetzigen konkurrierenden Gesetzgebung enthält, . . Zweifellos stehen wir hier am Rande eines ganz grundlegenden Rechtsproblems der Verfassung“. Es wird dann darauf hingewiesen, daß aufgrund des Artikels 125 insoweit nicht mehr die Länder, sondern nur noch der Bund zur Gesetzgebung befugt sei -„und zwar ohne die Einschränkungen des Artikels 72“.
Demgegenüber vertritt z. B. Kratzer (a. a. O.) den Standpunkt, der Begriff der konkurrierenden Gesetzgebung müsse im Abschnitt VII und im Abschnitt XI des Grundgesetzes der gleiche sein. Art. 125 im besonderen könne als Uebergangsvorschrift mit sozusagen akzessorischer Natur und untergeordnetem Charakter nicht weiter greifen als die Hauptvorschrift in Art. 72. Auf dem Umweg über Art. 125 könne nicht etwas Bundesrecht werden, was der Bundestag künftig nicht zum Bundesrecht machen könne; auf dem Umweg über Art. 125 könnten nicht Normen als Bundesgesetz eingeführt werden, die nicht von Rechts wegen, würden sie neu gesetzt, vom Bund erlassen werden könnten.
Dazu ist zu bemerken, daß die Ueberzeugung von der Notwendigkeit der jetzt getroffenen Regelung bereits die einhellige Auffassung des Herrenchiemseer Konvents gewesen ist. Der Verfassungsgesetzgeber hat diese Auffassung geteilt. Seinen Intentionen entspricht durchaus auch die Regelung des Spezialfalls der Abänderung früheren Reichsrechts, sowohl was den Fortfall des (im Herrenchiemscer Entwurf vorgesehenen) Erfordernisses seiner Geltung im ganzen früheren Reichsgebiet, als auch die Tatsache betrifft, daß eine Abänderung lediglich durch ein Land als ausreichend anzusehen ist. Noch in den letzten interfraktionellen Besprechungen am 4.5.1949 hat der Abgeordnete Dr. Laforet (CSU) als Vertreter der CSU laut Protokoll erklärt: „Fest stehe eins: das Recht, das in Abänderung früheren Reichsrechts ergangen sei, -einerlei durch wen -müsse Bundesrecht werden.“
Der Verfassungsgesetzgeber hat offensichtlich auf den Sachgebieten der konkurrierenden Gesetzgebung, sofern eine Regelung mindestens auf Zonenebene besteht oder eine, wenn auch inzwischen abgeänderte reichsrechtliche Normierung früher schon einmal erfolgt ist, durch eben diese Tatsache das Vorliegen eines Bedürfnisses nach einer Regelung von Bundes wegen ganz allgemein bereits als erwiesen angesehen. Diese Fiktion ist vollständig und erschöpfend. Auf das Vorliegen eines tatsächlichen Bedürfnisses im Einzelfall kommt es nicht an.
Im übrigen ist das Bedürfnis und nichts anderes auch die Voraussetzung für die erstmalige bundesrechtliche Regelung der sonstigen, dem Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung angehörenden und unter Artikel 74 fallenden Materien -nur mit einem Unterschiede: in diesen Fällen muß das Bedürfnis tatsächlich vorliegen. Auch genügt es nicht, daß der Bundesgesetzgeber lediglich ein generelles Bedürfnis für sein gesetzgeberisches Tätigwerden geltend macht.
Er muß vielmehr darüber hinaus, da die Bejahung des Bedürfnisses an bestimmte, im einzelnen aufgezählte Voraussetzungen geknüpft ist, jeweils dieses Bedürfnis in substantiierter Form unter Bezugnahme auf mindestens eine der drei in Artikel 72 niedergelegten Alternativen im einzelnen konkretisieren. Nur durch diese Konkretisierung kann der Bundesgesetzgeber auf dem bisher -gemäß Artikel 125 -bundesrechtlich noch nicht geregelten Gebiete die Schranken seiner Gesetzgebungskompetenz überwinden und den Rechtsboden für die Entstehung von Bundesrecht schaffen. Ist das aber einmal geschehen und auf einem bestimmten Sachgebiet -darunter ist zu verstehen jede einzelne begrifflich selbständige, in sich abgegrenzte Rechtsmaterie -einmal Bundesrecht entstanden, und zwar so erschöpfend, daß für eine eigenständige Betätigung der Landesgesetzgebung kein Raum belassen worden ist, so ist der Bundesgesetzgeber im Rahmen des Grundgesetzes in seiner weiteren Betätigung frei und nicht jeweils abhängig von einer erneuten Bedürfnisbejahung nach Artikel 72. Die Bedürfnisprüfung muß jedoch stattfinden, soweit zunächst das eigenständige Gesetzgebungsrecht der Länder nicht absorbiert worden ist und eine erschöpfende bundesgesetzliche Regelung erst später stattfinden soll.
Im übrigen begründet die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz des Bundes in jedem Falle nur ein Recht, jedoch keine Pflicht des Bundesgesetzgebers. Dieser ist deshalb auch befugt, u. U. bestimmte Materien, gegf. unter Aufhebung bisheriger Rechtssätze, von der Regelung auf der Bundesrechtsebene ganz oder teilweise auszuscheiden und einer Neuregelung auf der Landesrechtsebene zu überlassen, sei es im Hinblick auf einen nachträglichen Wegfall des Bedürfnisses im Sinne des Art. 72, sei es aus irgendwelchen anderen Gründen. Der Bundesgesetzgeber ist auch nicht gehindert, solche Sachgebiete später wieder an sich zu ziehen, allerdings dann nur unter den Voraussetzungen des Artikels 72.
Im übrigen sind diese Voraussetzungen, vor allem im Hinblick auf die Auslegung der Ziff. 3 in dem Genehmigungsschreiben der Militärgouverneure, von vornherein dazu angetan, die Bundeskompetenz in gewissen Grenzen zu halten.
In gleicher Weise unterliegt das in Artikel 125 aufgrund der Entscheidung des Verfassungsgesetzgebers zu Bundesrecht erklärte Recht nunmehr ausschließlich und uneingeschränkt der Disposition des Bundesgesetzgebers. Es wird Bundesrecht schlechthin, nicht etwa nur „unter den Voraussetzungen des Artikels 72.“ Daraus ergibt sich einmal: Der (einfache) Bundesgesetzgeber ist, da Bundesrecht bereits geworden ist, und zwar in vollem Umfang des jeweiligen Sachgebietes -Letzteres in obigem Sinne zu verstehen -, d. h. ohne Belassung eines Reservats für eine eigenständige Landesgesetzgebung, sobald er sich mit einer unter Artikel 125 fallenden Materie befaßt, nicht genötigt, zuvor erst (noch) einmal das Vorliegen eines Bedürfnisses in der in Artikel 72 geforderten Weise festzustellen. Allerdings ist er auch, wie auch sonst stets, berechtigt, gegf. unter Aufhebung des bisherigen (Bundes-)Rechts, eine Materie von der bundesrechtlichen Regelung ganz oder teilweise wieder auszunehmen und die Neuregelung den Ländern zu überlassen. Das wird allerdings nur in Ausnahmefällen in Betracht kommen können (Zweck des für die Länder eingetretenen Gesetzgebungsstops, Gefahr der Rechtszersplitterung !). Auch hier kann der Bundesgesetzgeber die betreffenden Materien wieder an sich ziehen, indes müssen alsdann die Voraussetzungen des Artikels 72 gegeben sein. Der Artikel 125 bezweckt nicht, das von dieser Bestimmung betroffene Recht ein für alle Mal in bundesverfassungsrechtskräftiger Weise zu Bundesrecht zu erklären -sodaß die Ausscheidung eines Gebietes lediglich durch verfassungsänderndes Gesetz möglich wäre -; er will vielmehr durch die Erklärung zu Bundesrecht in erster Linie insoweit mit sofortiger Wirksamkeit die uneingeschränkte Kompetenz des Bundesgesetzgebers festlegen, die ihm erforderlich erscheinenden gesetzgeberischen Schritte, gleich welcher Art, durchzuführen. Zum anderen ist weder das zu Bundesrecht erklärte bisherige Recht noch etwaiges vom Bundesgesetzgeber auf diesen Rechtsgebieten neugesetzte Recht einer Nachprüfung durch das Bundesverfassungsgericht oder anderen Instanzen anhand des in Art. 72 normierten Maßstabes unterworfen.
Zusammenfassend ist zu sagen: Die Bedeutung des Artikels 125 liegt einmal in seiner Sperrwirkung gegenüber der Landesgesetzgebung und zum andern in der Begründung einer sofort wirksamen und uneingeschränkten Kompetenz des Bundesgesetzgebers, auf den unter Artikel 125 fallenden Gebieten alle ihm erforderlich erscheinenden gesetzgeberischen Maßnahmen zu treffen.
3. Artikel 126 (Einschaltung des Bundesverfassungsgerichtes):
Eine diesbezügliche Vorschrift sah bereits der Herrenchiemseer Entwurf in folgender Form vor:
Entsteht Streit darüber, ob . . ein Gesetz oder eine Verordnung als Bundesrecht oder als Landesrecht fortgilt, so entscheidet darüber der Bundesjustizminister im Einvernehmen mit einem Minister des Landes oder der Länder, deren Recht betroffen wird. Den zuständigen Landesminister bestimmt die Landesregierung. Die Entscheidung ist für alle Gerichte und Behörden bindend.
In der Begründung hieß es, diese Regelung erscheine erforderlich, um durch eine derartige rasch zu schaffende Klärung schädliche Unsicherheit im Rechts- und Wirischaftsleben zu beseitigen. Bundes- oder Landesinteressen würden dadurch nicht verletzt, da die Entscheidung nur im Einvernehmen von Bund und Ländern erfolgen könne. Komme eine Einigung zwischen Bundesjustizminister und Landesminister nicht zustande, so könne der Bundesjustizminister nicht entscheiden, vielmehr bestehe dann die Möglichkeit, die Streitfrage vor dem Bundesverfassungsgericht auszutragen.
Der Organisationsausschuß übernahm im Prinzip die vorgeschlagene Regelung, jedoch mit der Abänderung, daß der Bundesjustizminister entscheiden sollte „im Einvernehmen mit der Landesregierung des Landes, dessen Recht betroffen wird.“ An dieser Regelung wurde indes gerügt, die Fassung lasse nicht erkennen, ob streitende Parteien nur Bund und Länder oder auch andere Körperschaften oder sogar Privatpersonen sein könnten. Es müsse allerdings angenommen werden, daß nur Streitigkeiten zwischen Bund und Ländern (oder zwischen Ländern?) gemeint seien. Auch sei es besser, statt von der Entscheidung eines Streites nach dem Vorbild der Weimarer Verfassung von dem „Bestehen von Meinungsverschiedenheiten“ zu sprechen. Besonders bedenklich erscheine, als entscheidende Stellen einen Bundes- bzw. Landesminister, also Organe der Exekutive vorzusehen, obwohl es sich um die Entscheidung reiner Rechtsfragen handele, die richtigerweise Organen der Rechtsprechung überlassen werden müsse. Deshalb sei es richtiger, die Entscheidung von vornherein dem Bundesverfassungsgericht zu übertragen. Zumindest aber solle, statt des Justizministers, die Bundesregierung eingeschaltet werden.
Unter Berücksichtigung dieser Bedenken schlug der Allgemeine Redaktionsausschuß unter dem 18.11.1948 folgende Fassung vor:
Bei Streitigkeiten (Meinungsverschiedenheiten) über die Vereinbarkeit des in Artikel 139 (jetzt Artikel 123) bezeichneten Rechts mit diesem Grundgesetz sowie über die Fortgeltung von Recht als Bundesrecht gemäß den Vorschriften in Artikel 139 a und Artikel 139 b (jetzt Art. 124 und 125) entscheidet das Bundesverfassungsgericht.
In der Begründung wurde besonders hervorgehoben, daß es nicht angehe, daß praktisch ein Minister die Entscheidung darüber treffen könnte, ob künftig der Bundes- oder der Landesgesetzgeber tätig werden solle. Wenn dagegen das Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung berufen sei, so verhalte es sich damit ähnlich wie bei den ihm sonst zukommenden Funktionen, soweit es sich nämlich mit der Vereinbarkeit von Rechtsvorschriften untereinander zu befassen habe. Die Tatsache, daß es sich hier um Streitigkeiten handele, die aus einem Uebergangszustand entstehen könnten, seien nicht so entscheidend, daß ein Abgehen von der sonstigen Systematik gerechtfertigt sei. Die Stichhaltigkeit dieser Argumentation wurde allseits anerkannt und der Artikel, mit einer geringen, vom Organisationsausschuß angeregten, sprachlich stilistischen Aenderung, vom Hauptausschuß in erster Lesung (20. Sitzung) gegen eine Stimme in der Fassung angenommen:
Meinungsverschiedenheiten über….entscheidet das Bundesverfassungsgericht.
In einem zweiten Absatz war außerdem die Veröffentlichung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im Bundesgesetzblatt vorgesehen. Ein Vorschlag des Abg. Dr. de Chapeaurouge (CDU), statt des Bundesverfassungsgerichts das Oberste Bundesgericht einzuschalten, hatte keinen Anklang gefunden. In dieser Form ging der Artikel auch durch die zweite und dritte Lesung des Hauptausschusses (39. bzw. 51. Sitzung); lediglich das Wort „Fortgeltung“ war auf Vorschlag des Redaktionsausschusses durch „Fortgelten“ ersetzt und der zweite Absatz wieder gestrichen worden.
Die endgültige Fassung erhielt der Artikel in der vierten Lesung des Hauptausschusses auf Grund eines neuen Vorschlags des Redaktionsausschusses. Dieser war hierbei von der Ueberlegung ausgegangen, daß die Frage, ob bisheriges Recht überhaupt weitergelte bzw., in einem gegebenen Falle, wegen Unvereinbarkeit mit dem Grundgesetz nichtig sei, bereits von der Bestimmung des Artikels 93 Absatz 1 Ziff. 2 mitumfaßt wird, derzufolge das Bundesverfassungsgericht bei Meinungsverschiedenheiten und Zweifeln über die förmliche und sachliche Vereinbarkeit von Bundesund Landesrecht mit dem Grundgesetz -gleichgaltig ob es sich um neues oder altes Recht handelt -auf Antrag bestimmter Stellen zu entscheiden hat. Die Frage der Weitergeltung einer Norm des bisherigen Rechts kann danach ebenfalls der Kognition des Bundesverfassungsgerichts unterbreitet werden, ohne daß es zu einem eigentlichen Streit (Streitigkeit) -der Begriff „Streitigkeit“ sowie derjenige „Meinungsverschiedenheit“ sind als Synonyma anzusehen -gekommen sein muß. Liegt aber ein eigentlicher Streit über die Weitergeltung einer Rechtsnorm vor, so braucht er nicht zwischen der Bundesregierung und einer oder mehrerer Länderregierungen, ja wohl überhaupt nicht zwischen Bundes- und Landesbehörden entstanden zu sein. Das Antragsrecht der Bundes- und jeder Landesregierung ist in jedem Falle eines Zweifels oder einer Meinungsverschiedenheit gegeben.
Besonders hinzuweisen ist dabei auf die Rechtslage für den Fall, daß die Frage der Vereinbarkeit mit den GG und damit der Weitergeltung einer Norm des bisherigen Rechts vor bzw. bei einem Gericht akut wird. Soweit es sich bei der Rechtsnorm um ein Gesetz handelt, kommt es darauf an, ob auch solche Fälle nach Artikel 100 Abs. 1, der ein durch ein entsprechendes Entscheidungsmonopol des Bundesverfassungsgerichts beschränktes richterliches Prufungsrecht vorsieht, zu beurteilen sind, d. h. ob das Gericht bei Verneinung der Vereinbarkeit das Verfahren auszusetzen und die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts einzuholen hat. W. Jellinek hat in seinem Aufsatz „Das richterliche Prüfungsrecht in den Ländern der amerikanischen Besatzungszone“ (Festgabe für Laun 1948 S. 268 ff,.) die Meinung vertreten, die Bestimmungen der Landesverfassungen über das richterliche Prüfungsrecht beträfen nach ihrer Entstehungsgeschichte, ihrem Sinn und Zweck lediglich Gesetze, die nach Inkrafttreten und aufgrund der Verfassungen ergangen seien. Das hebt die württembergisch-badische Verfassung in Art. 93 Absatz 2 besonders hervor und war z. B. auch in den ersten Entwürfen der hessischen Verfassung ausdrucklich gesagt. Dagegen kann nach Jellinek die Vereinbarkeit früherer Gesetze mit den jeweiligen Landesverfassungen von den Gerichten generell und unein geschränkt nachgeprüft werden gemäß dem allgemeinen Rechtsgrundsatz „lex posterior derogat . . .“. Diese Auflassung dürfte richtig sein und auch für den Bereich des Grundgesetzes zutreffen. Bereits der 34. deutsche Juristentag in Köln 1926 ging davon aus, daß die damals vorgeschlagenen Spezialvorschriften über die Prüfung der Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen (einschließlich der darin vorgesehenen Begründung der Zuständigkeit des Reichsstaatsgerichtshofes) logisch und systematisch sich nur auf Gesetze der vorbezeichneten Art beziehen könnten. Die ganze Problematik der richterlichen Nachprüfung von Gesetzen und damit auch der Tragweite jeder diesbezüglichen ausdrücklichen Vorschrift, unabhängig davon, ob sie in einer Verfassungsurkunde verankert ist oder nicht, ist wesentlich bedingt einmal durch die grundsätzliche Stellung die der Legislative -im Bundesstaat kommen dabei neben der Bundeslegislative auch die Landeslegislativen in Frage -gerade im Rahmen der betreffenden konkreten verfassungsmäßigen Ordnung eingeräumt ist -vor allem in ihrem Verhältnis zur Verfassung selbst -und zum zweiten durch die Bedeutung, die den Gerichten nach der Verfassung im gesamten zukommt. Das erste Moment entfällt völlig bei Akten, die überhaupt nicht Akte dieser Legislative sind. Das zweite Moment ist im Grundgesetz dadurch gekennzeichnet, daß die Gerichte als die Organe der dritten, der rechtsprechenden Gewalt Rechtsschutz in denkbar weitestem Umfange üben sollen.
Aus dieser Ueberlegung ergibt sich: Artikel 100 Abs. 1 bezieht sich nur auf Rechtsnormen, die als „Gesetze“ des Bundes oder der Länder (im formellen Sinne) nach Inkrafttreten des Grundgesetzes und (gemäß Artikel 122) nach Zusammentritt des Bundestages ergehen -mit der einzigen Ausnahme, daß es sich im Falle der ersten Alternative des zweiten Satzes allerdings auch um Landesrecht, das nicht Gesetzesrecht ist, handeln kann. Vor diesem Zeitpunkt ergangenes Recht wird jedenfalls dann nicht erfaßt, wenn es als Bundesrecht fortgilt, ebensowenig, wie nach diesem Termin erlassene sonstige bundesrechtliche Normen. Unbeschadet der Vorschrift des Artikels 93 haben die Gerichte insoweit ein volles, allerdings diffuses und nur incidenter auszuübendes Prüfungsrecht, in genau der gleichen Weise, wie zum Beispiel nach herrschender und zutreffender Lehre unter der Weimarer Reichsverfassung die Gerichte nicht nur reichsrechtliche Verordnungen auf ihre Gesetzes- und Verfassungsmäßigkeit nachprüfen konnten, sondern auch landesrechtliche Vorschriften jedweder Art auf ihre Einbarkeit mit dem Reichsrecht, obwohl im letzteren Falle gemäß Artikel 13 der Weimarer Verfassung und dem dazu ergangenen Ausführungsgesetz von bestimmten Stellen eine Entscheidung des Reichsgerichtes eingeholt werden konnte. Die Gerichte sind grundsätzlich also befugt, die Vereinbarkeit bisherigen Rechts mit dem Grundgesetz -zwar nicht prinzipaliter, d. h. nicht als Haupt-, sondern nur als Incidentpunkt, als Vorfrage nachzuprüfen und, je nach der Sachlage, zu bejahen oder zu verneinen. Den dazu berufenen Stellen bleibt es unbenommen, ggf. von sich aus eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gemäß Artikel 93 Abs. 1 Ziff. 2) herbeizuführen, eine Möglichkeit, die ihnen auch gegeben ist, wenn z. B. ein Gericht auf Grund der durch Artikel 100 gegebenen Möglichkeit die Vereinbarkeit eines vom Bundesgesetzgeber erlassenen Bundesgesetzes mit dem Grundgesetz bejaht hat.
Auch soweit es sich um die Frage handelt, auf welcher Rechtsebene bisheriges Recht weitergilt, ob als Bundes- oder als Landerecht, entscheidet gemäß Artikel 126 das Bundesverfassungsgericht, allerdings nur dann, wenn es darüber zu einer „Meinungsverschiedenheit“, d. h. zu einem konkreten Streit gekommen ist. Dabei können, wie die Entstehungsgeschichte ergibt, insoweit Streitpartner wohl nur der Bund und ein Land (bzw. mehrere Länder) sein.
Wenn in einem Rechtsstreit vor einem Gericht die Frage streitig wird, ob eine Norm des bisherigen Rechts gemäß Artikel 124 / 126 zu Bundesrecht oder zu Landesrecht geworden ist, so können die Gerichte nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen, kraft ihres vollen richterlichen Prüfungsrechtes, incidenter auch diese Frage mitentscheiden. Kommt es darüber zu einer „Meinungsverschiedenheit“ im Sinne des Artikels 126 -allerdings auch nur in diesem Fall -, dann kann das Bundesverfassungsgericht um eine Entscheidung angegangen werden.
4. Artikel 127 (Einführung fortbestehenden Rechts der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebiete in der französischen Zone und Berlin):
Dieser Arlikel geht zurück auf einen Vorschlag des Allgemeinen Redaktionsausschusses vom 16.11.1948, der allerdings die Einführung nur in den Ländern der französischen Zone vorsah. Die für die Einführung vorgesehene Frist (ursprünglich waren sechs Monate vorgeschlagen) wurde zunächst vom Organisationsausschuß (27. Sitzung) und ebenso in der ersten Lesung des Hauptausschusses (20. Sitzung) gestrichen. Man glaubte, von einer Frist absehen und die erforderlichen Schritte der Initiative der Bundesregierung überlassen zu sollen.
In seinem Vorschlag vom 16.12.1948 wies jedoch der Redaktionsausschuß auf die unbedingte Notwendigkeit einer Befristung hin, schlug aber nunmehr die Frist von einem Jahre vor. Es wurde geltend gemacht, daß es sich um ein exzeptionelles Recht der Bundesregierung handele, das die Einführung dieses Rechts in den Ländern der französischen Zone während einer Zeit ermöglichen solle, in der der erste Bundestag durch ein Uebermaß an gesetzgeberischen Aufgaben besonders belastet sei. Nach einem Jahre aber müsse der Gesetzesapparat so laufen, daß dann nur noch der ordentliche Gesetzesweg beschritten werden dürfe. Nunmehr schloß sich auch der Organisationsausschuß (in seiner 30. Sitzung) dieser Argumentation an, zumal nachdem ein Vertreter der französischen Zone, der Abg. Dr. Finck (CDU), darauf hingewiesen hatte, daß gerade von deren Standpunkt aus in dieser Frist ein wünschenswertes Mittel zur Ermöglichung schnellerer Rechtsangleichung erblickt werden müsse. Der Artikel wurde dann mit der vorgesehenen Fristbestimmung vom Hauptausschuß in zweiter Lesung (30. Sitzung) und, nachdem auf Vorschlag des Redaktionsausschusses die Formulierung „Regierungen der beteiligten Länder“ gebilligt sowie auf Anregung des Fünfer-Ausschusses Groß-Berlin miteinbezogen worden war, auch in dritter Lesung (51. Sitzung) sowie vom Plenum angenommen. Die Inkraftsetzung erfolgt jeweils durch „gesetzesvertretende“ Verordnung.
Artikel 127 findet auch Anwendung auf den staatsrechtlich nach wie vor zu Bayern gehörenden, jedoch in die französische Besatzungszone einbezogenen Kreis Lindau.
5. Artikel 128 (Weisungsrechte in fortgeltendem Recht):
In Artikel 84 Absatz 5 ist bestimmt, daß der Bundesregierung durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, zur Ausführung von Bundesgesetzen -es handelt sich um Fälle, wo diese Ausführung eigene Angelegenheit der Länder ist -die Befugnis verliehen werden kann, für besondere Fälle Einzelweisungen zu erteilen. In dem Bericht des Berichterstatters Abg. Dr. Laforet (CSU) heißt es hierzu: „Die Anregung, für solche Ausnahmefälle auch die Befugnis zu allgemeinen Weisungen zu erteilen, ist abgelehnt worden“. Die Weisungen sind, außer wenn die Bundesregierung den Fall für dringlich erachtet, an die obersten Landesbehörden zu richten. In einem solchen Dringlichkeitsfall wird also die sonstige „strenge Verbandsaufsicht“, die ein Land nur als geschlossene Einheit erfaßt und sich deshalb nur an die Regierung richtet, zur unmittelbaren, also „durchgreifenden“ Aufsicht. Die in der vierten Lesung des Hauptausschusses beschlossene Fassung „außer wenn…..“ -anstelle der ursprünglichen Formulierung „außer bei Gefahr im Verzuge“ -stellt klar, daß es ausschließlich Sache der Bundesregierung ist, über das Vorliegen eines derartigen Dringlichkeitsfalles zu befinden, daß also eine Nachprüfung durch das Bundesverfassungsgericht insoweit ausgeschlossen ist.
Derartige Weisungen können nun auch in bisherigem, gem. Art. 123 bzw. 124 oder 125 fortgeltendem Recht vorgesehen sein. Diesem Umstand trug der Organisationsausschuß Rechnung durch Einfügung der Bestimmung des jetzigen Artikels 128 (30. Sitzung). Der Hauptausschuß schloß sich dem Vorschlag in zweiter Lesung (39. bzw. 45. Sitzung) an. Seine jetzige Gestaltung erhielt der Artikel in der dritten Lesung des Hauptausschusses (51. Sitzung), der dabei einer Anregung des Redaktionsausschusses vom 25. 1. 1949 bzw. des Fünfer-Ausschusses folgte.
Auf Weisungsrechte des bisherigen Rechtes hatte der Abg. Dr. Strauß (CDU) in der 45. Sitzung des Hauptausschusses des näheren hingewiesen und dabei erklärt: „Wir hatten diese Weisungsrechte schon -und das ist interessant -seit dem Norddeutschen Bund. Das erste Gesetz dieser Art war das Gesetz zur Bekämpfung der Rinderpest vom 7. April 1869. Wir hatten solche Rechte im Viehseuchengesetz, im Gesetz zur Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten, im Reblausgesetz, aber auch im Auswanderungsgesetz und im Schiffsvermessungsgesetz und noch an einigen anderen Stellen. Und dann haben wir noch die Fälle in der bizonalen Gesetzgebung gehabt, die schon erwähnt wurden. Selbstverständlich müssen alle diese Rechte aufrecht erhalten werden“.
Auf Grund eines Antrages der Abg. Dr. Menzel-Dr. Hoch (SPD) hatte der Hauptausschuß in der 45. Sitzung beschlossen, diesem Uebergangsartikel noch einen zweiten Absatz hinzuzufügen, der besagte, daß bei neuen Gesetzen über Maßnahmen gegen gemeingefährliche und übertragbare Krankheiten bei Menschen und Tieren die sonst erforderliche Zustimmung des Bundesrates bzw. die Zustimmung mit qualifizierter Mehrheit nicht nötig sei. Gesetze dieser Art sollten also von der generellen Regelung -sie findet sich jetzt in Artikel 84 Absatz 5 -ausdrücklich ausgenommen werden. Nachdem indes der Redaktionsausschuß in seiner Stellungnahme vom 25.1.1949 betont hatte, es sei kaum anzunehmen, daß bei einer Neuregelung dieser Gesetze der Bundesrat die Zustimmung zur Einführung entsprechender Bestimmungen verweigern werde, und der Fünfer-Ausschuß sich dem angeschlossen hatte, wurde dieser zweite Absatz in der dritten Lesung des Hauptausschusses (51. Sitzung) wieder gestrichen.
6. Artikel 129 (Uebergang der Ermächtigung zum Erlaß von Rechtsverordnungen usw. auf andere Stellen; Ersatz fortgefallener Vorschriften und Einrichtungen):
Der Artikel hat seinen. Ursprung ebenfalls im Herrenchiemseer Entwurf. Dieser bestimmte in seinem Artikel 141:
Soweit in Gesetzen, die als Bundesrecht fortgelten die Befugnis, Verordnungen zu erlassen oder Verwaltungsakte vorzunehmen, auf Stellen übertragen ist die nicht mehr bestehen, wird die Befugnis von den Stellen ausgeübt, die nach dem Grundgesetz zuständig sind.
Im Artikel 142 Herrenchiemseer Entwurf wurde gesagt:
Soweit in Gesetzen und Verordnungen auf reichsrechtliche Vorschriften oder Einrichtungen verwiesen ist, die durch dieses Grundgesetz aufgehoben sind oder aus sonstigen Gründen nicht mehr bestehen, treten an ihre Stelle die entsprechenden Vorschriften und Einrichtungen dieses Grundgesetzes.
Im Organisationsausschuß (18. Sitzung) wurde dem Artikel 141 H.-E. die Bestimmung angefügt:
In Zweifelsfragen bestimmt die Bundesregierung die jetzt zuständigen Stellen.
Einen entsprechenden Zusatz erhielt der Artikel 142 Herrenchiemseer Entwurf.
Von der Kritik wurde mit Recht eine Lücke darin erblickt, daß der Erlaß von „allgemeinen Verwaltungsvorschriften“ damit nicht geregelt war, außerdem wurde eine Veröffentlichung der in Zweifelsfällen ergehenden Entscheidungen der Bundesregierung für erforderlich gehalten. Diesen Bedenken trug der Allgemeine Redaktionsausschuß in seinem Vorschlag vom 18.11.1948 Rechnung: er bezog die allgemeinen Verwaltungsvorschriften mit ein und schlug auch die Veröffentlichung etwaiger Entscheidungen vor. Die Veröffentlichung kann im Bundesgesetzblatt, dem Bundesanzeiger oder an anderer Stelle erfolgen. Ferner nahm der Redaktionsausschuß den Artikel 142 H.-E. als besonderen Absatz in den Artikel 141 mit auf. Von wesentlicher Bedeutung war weiter, daß der Redaktionsausschuß das Alleinentscheidungsrecht der Bundesregierung beseitigen und statt dessen bestimmen wollte:
In Zweifelsfällen entscheidet die Bundesregierung im Einvernehmen mit dem Bundesrat.
Schließlich stellte es der Redaktionsausschuß in der Frage der Zuständigkeit nicht mehr ausschließlich nur auf das Grundgesetz ab, sondern auf die Gesamtheit der nunmehrigen Rechtslage und ließ infolgedessen die Zuständigkeit auf die „nunmehr zuständigen“ Stellen übergehen. Im Hinblick darauf, daß in zahlreichen Fällen frühere Ermächtigungen vorgesehen sind für Stellen, die mit dem Wegfall des „Dritten Reiches“ ebenfalls entfallen sind, wie etwa Gauleiter, Reichsverteidigungskommissare u. ä., wurde erwogen, ob diese Stellen außerdem noch „entsprechende“ sein müßten. Klargestellt wurde auch, daß die nach Art. 80 des Grundgesetzes zum Erlaß von Rechtsverordnungen jeweils erforderliche spezielle Ermächtigung, d. h. Ermächtigung jeweils nur für einen gegenständlich begrenzten Bereich, -eine generelle Ermächtigung, d. h. eine solche für einen gegenständlich unbegrenzten Bereich, ist nicht vorgesehen -dann vorliegt, wenn eine solche Ermächtigung in den fortgeltenden alten Rechtsvorschriften enthalten ist.
Der Redaktionsausschuß hielt auch die Regelung des Uebergangs solcher Ermächtigungen für erforderlich, die in Rechtsvorschriften enthalten sind, die als Landesrecht fortgelten, und schlug deshalb die Bestimmung vor, die als Absatz 2 in Artikel 129 in die endgültige Gesetzesfassung übergegangen ist. Insoweit ist nicht erforderlich, daß die Zuständigkeit jeweils nur für den Einzelfall ausgesprochen ist; sie kann vielmehr auch allgemein statuiert sein, wie z. B. in den Gesetzen der Länder der amerikanischen bzw. der französischen Zone betreffend den Erlaß von Rechtsverordnungen.
Die Vorschläge des Redaktionsausschusses wurden vom Organisationsausschuß in seiner 27. Sitzung angenommen; ebenfalls schloß sich der Hauptausschuß in der ersten Lesung (20. Sitzung) an. Nach einer, vom Redaktionsausschuß angeregten, redaktionellen Verbesserung des jetzigen Absatzes 4 fügte der Hauptausschuß in zweiter Lesung (39. Sitzung) zum Zwecke der Klarstellung zwischen die Worte „nunmehr“ und „zuständigen“ noch das Wort „sachlich“ ein. Eine Anregung des Abg. Dr. Menzel (SPD), in Zweifelsfällen die Bundesregierung allein (ohne Bundesrat) entscheiden zu lassen, fand keinen Anklang, nachdem insbesondere der Abg. Dr. Süsterhenn (CDU) darauf hingewiesen hatte, die zuständigen Stellen könnten sowohl Bundes- wie Landesstellen sein. Einem Vorschlag des Redaktionsausschusses vom 25.1.1949 entsprechend, wurde in der dritten Lesung des Hauptausschusses (51. Sitzung) der jetzige Absatz 3 eingefügt, nach dem Ermächtigungen zum Erlaß von Aenderungs-, Ergänzungs- oder gesetzesvertretenden Rechtsverordnungen erloschen sind.
Die Statuierung der Entscheidungsbefugnis der Bundesregierung im Einvernehmen mit dem Bundesrat in Absatz 1 erscheint insofern nicht systemwidrig und unzweckmäßig, als es sich hier nicht um die Frage der Begründung von Zuständigkeiten, sondern lediglich darum handelt, welche Stellen im Einzelfall bestimmte Zuständigkeiten ausüben sollen. Die Bestimmung dieser Stellen kann in zahlreichen Fällen in erster Linie von Gesichtspunkten politischer Zweckmäßigkeit abhängig sein. Es handelt sich jedoch nicht jeweils um eine ausschließlich politische Frage, sie hat vielmehr auch in gewissem Umfang eine rechtliche Seite. Diese kann unter Umständen zu kurz kommen. Da die Entscheidungsbefugnis der Bundesregierung und des Bundesrates als eine ausschließliche anzusehen ist, kommt die rechtliche Seite überhaupt nicht zum Tragen, sobald einmal eine derartige Entscheidung ergangen ist. Es ist deshalb nicht möglich, daß z. B. ein Land, das eine von der Bundesregierung und der Mehrheit des Bundesrates getroffene Entscheidung aus Rechtsgründen nicht glaubt annehmen zu können, von sich aus gegen diese Entscheidung das Bundesverfassungsgericht anruft.
Aber auch dann, wenn eine solche Entscheidung nicht vorliegt (z. B. weil ein Einvernehmen zwischen Bundesregierung und Bundesrat nicht zu erzielen war), kann mit Rücksicht auf die Ausschließlichkeit der in Artikel 129 normierten Zuständigkeit ein Land nicht etwa unter Berufung auf das Vorliegen einer „öffentlich rechtlichen Streitigkeit“ im Sinne des Artikels 93 das Bundesverfassungsgericht um eine Entscheidung darüber, welche Stelle gemäß Absatz 1 als ermächtigt anzusehen ist, angehen. Dagegen kann sowohl das Bundesverfassungsgericht -im Rahmen eines sonstigen, bei ihm anhängigen Verfahrens -wie auch jedes andere Gericht -im Zuge irgendeines Rechtsstreites -diese Frage als Incidentpunkt prüfen und insofern selbst mitentscheiden, jedoch nur so lange, als eine Entscheidung nach Absatz 1 nicht vorliegt. Eine ergangene und veröffentlichte Entscheidung ist, wie für alle übrigen Stellen, auch für die Gerichte verbindlich.
Allerdings bezieht sich die Entscheidungskompetenz nach Absatz 1 ausschließlich auf die Bestimmung der nunmehr als zuständig anzusehenden Stellen. Die Entscheidungsbefugnis erstreckt sich nicht auf die Rechtsfrage, ob das bisherige Recht, das die betreffende Ermächtigung enthält, überhaupt noch fortgilt oder gegebenenfalls wegen Unvereinbarkeit mit dem Grundgesetz seine Geltung verloren hat. Hier gelten die bei der Erörterung des Artikels 126 dargelegten Grundsätze. Wenn nun ein Gericht (ordentliches oder Verwaltungsgericht) bei seiner (insoweit in jedem Fall incidenter vorzunehmenden) Prüfung bzw. das Bundesverfassungsgericht bei einer Anrufung gemäß Artikel 93 Ziffer 2 zu dem Ergebnis gelangt, daß die die Ermächtigung enthaltende Rechtsvorschrift gar nicht mehr gilt und damit eine gesetzliche Grundlage für den Erlaß des in Frage stehenden Staatsaktes -Verordnung oder Verwaltungsakt (die allgemeinen Verwaltungsvorschriften scheiden als reine Verwaltungsinterna hier aus) -überhaupt nicht vorhanden ist, dann ist eine gemäß Absatz 1 ergangene Entscheidung kein Ersatz für die nicht vorhandene Rechtsgrundlage. Sie ist vielmehr insofern „gegenstandslos“ und der betreffende Staatsakt nach den Grundsätzen über die Behandlung fehlerhafter Staatsakte zu beurteilen. Eine Verordnung ist nichtig, ein Verwaltungsakt desgleichen, wenn man, entsprechend einer neuerdings vielfach vertretenen Auffassung (vgl. z.B. Bettermann in der Monatsschrift für Deutsches Recht, Juli 1949, S. 394 ff.), die Ultra-vires-Lehre auf jeden Staatsakt „sine lege“ anwendet; andernfalls ist ein derartiger Verwaltungsakt bis zu seiner Aufhebung -durch die Exekutive bzw. Verwaltungsgerichtsurteil -als gültig anzusehen.
Im Falle des Absatz 2 richtet sich die Erledigung von Zweifelsfällen nach den Vorschriften des Landes(verfassungs-)rechts.
Im Falle des Absatz 4 sollen die Vorschriften der Absätze 1 und 2 „entsprechend gelten.“ Hier muß aber eine Einschränkung gemacht werden. Es kann nicht Aufgabe der Bundesregierung und des Bundesrates sein, zu entscheiden, welche neuen Rechtsvorschriften anstelle der nicht mehr geltenden (insbesondere früherer reichsrechtlicher) Bestimmungen, auf die in Rechtsvorschriften verwiesen wird, getreten sind. Diese Ersatzvorschriften können bundes- oder landesrechtlicher Art sein. In jedem Falle handelt es sich insoweit um die Feststellung geltenden Rechtes, also eine reine Rechtsfrage. Dafür aber sind ausschließlich die Gerichte bzw. das Bundesverfassungsgericht zuständig.
Einen besonderen Hinweis erfordert noch die Bestimmung des Absatz 3, nach der Ermächtigungen zum Erlaß von Rechtsvorschriften bestimmter Art erloschen sind. Die Fassung ist insofern rechtssystematisch nicht ganz glücklich, als der Begriff „gesetzesvertretende Rechtsverordnung“ -diese Verordnungsart ist mit dem Ausdruck „Rechtsvorschrift anstelle von Gesetzen“ gemeint -gerade dadurch gekennzeichnet ist, daß in diesem Falle die Ermächtigung den sogen. „Vorrang des Gesetzes“ immer mit einbezieht, d. h. daß durch eine derartige Verordnung stets auch ein (formelles) Gesetz abgeändert und aufgehoben werden kann (vgl. Jakobi, Handbuch des Deutschen Staatsrechts, 2. Band S. 248 ff.). Die ein Gesetz abändernde Rechtsverordnung ist also, streng genommen, keine besondere Art von Rechtsverordnung neben der gesetzesvertretenden. Das Grundgesetz gibt in Artikel 119 der Bundesregierung das Recht, mit Zustimmung des Bundesrates bis zu einer bundesgesetzlichen Regelung in Flüchtlings- und Vertriebenenangelegenheiten Verordnungen mit Gesetzeskraft zu erlassen. Hier ist -ausnahmsweise -eine besondere Ermächtigung zu gesetzesvertretenden Rechtsverordnungen geschaffen. Durch derartige Verordnungen können auch gesetzliche Vorschriften abgeändert und aufgehoben werden.
Alle sonstigen, auf Grund gesetzlicher Ermächtigung (Artikel 80) ergehenden Rechtsverordnungen sind nicht „gesetzesvertretend“. Bis zur dritten Lesung im Hauptausschuß enthielt der Grundgesetzentwurf eine ausdrückliche Vorschrift, daß die Befugnis zur Gesetzgebung nicht übertragen werden könne. Diese Bestimmung wurde vom Hauptausschuß, einem Vorschlag des Redaktionsausschusses folgend; in vierter Lesung gestrichen, jedoch nur, weil man sie für selbstverständlich hielt. Jede gesetzesvertretende Verordnung beruht aber auf einer derartigen Delegation der gesetzgebenden Gewalt.
Ob im übrigen vom Gesetzgeber nicht nur die Ermächtigung gegeben werden kann, Ausführungsverordnungen zu erlassen -also solche, die keine neuen selbständigen Rechtsgedanken enthalten, vielmehr nur das im Gesetz Gewollte entfalten und weiterführen -, sondern auch die Ermächtigung zu Verordnungen, die, falls der Gesetzgeber einen Gegenstand selbst nicht abschließend regelt, im Rahmen des Gesetzes die nähere Regelung treffen (Durchführungsbestimmung im engeren Sinne), oder gar zu Verordnungen, die ein Gesetz ergänzen, muß an dieser Stelle dahingestellt bleiben. Der amtliche Bericht des Abg. Dr. Laforet bejaht diese Frage.
Auf Grund des Artikels 129 sind jedenfalls z. B. Ermächtigungen auf Grund landesrechtlicher Blankettgesetze zum Erlaß von Polizeiverordnungen -d. h. Ergänzungs-Verordnungen -erloschen.
7. Artikel 117
a) Absatz 1 (zeitlich begrenzte Aufrechterhaltung des dem Artikel 3 Abs; 2 -Gleichherechtigung der Frau -entgegenstehenden Rechts):
Der uneingeschränkten Gleichberechtigung (Gleichstellung) der Frau mit dem Manne statuierende Artikel 3 Absatz 2 hat seine jetzige Fassung erst in der dritten Lesung des Hauptausschusses auf Grund eines von der Abg. Dr. Selbert (SPD) gestellten Antrages erhalten. Die in dieser Beziehung vom Hauptausschuß in erster Lesung beschlossene Fassung hatte noch gelautet: „Männer und Frauen haben die gleichen staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten“. Außerdem fand sich bereits der jetzige Absatz 3: „Niemand darf wegen seines Geschlechtes . . . benachteiligt oder bevorzugt werden“. Auf die letztgenannte Bestimmung bezog sich die vom Redaktionsausschuß (unter dem 18.11. bzw. 16.12.1948) vorgeschlagene Vorschrift:
Die . . . entgegenstehenden Vorschriften des Bürgerlichen Rechtes über die Stellung der Frau bleiben bis zu ihrer Anpassung an diese Bestimmung des Grundgesetzes in Kraft, jedoch nicht länger als bis zum 31.3.1953.
Der Hauptausschuß setzte jedoch die Beschlußfassung über diese Vorschrift bis zur zweiten Lesung aus. In dieser wurde sie angenommen, während der Gleichheitsartikel einen Absatz 2 folgenden Wortlauts erhielt:
Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Die Gesetzgebung hat dies auf allen Rechtsgebieten zu verwirklichen.
Redaktionsausschuß und Fünfer-Ausschuß empfahlen indes einerseits für den Gleichheits-Artikel die Annahme der in dem Antrag der Abg. Dr. Selbert (SPD) vorgeschlagenen Fassung und andererseits eine Uebergangsbestimmung in der allgemein gehaltenen Formulierung: „Entgegenstehendes Recht“, wie sie dann auch Gesetz geworden ist.
Der Artikel 3 Absatz 2 sichert die unbedingte Gleichberechtigung der Frau in jeder, insbesondere in staatsbürgerlicher und zivilrechtlicher Hinsicht.
Diese Gleichberechtigung ist mit dem Inkrafttreten des Grundgesetzes verfassungsmäßig verankert, sie ist unmittelbar geltendes und zwingendes Recht, das insbesondere auch den Gesetzgeber bei jedem Akt neuer Rechtssetzung bindet. Auch sind alle dem entgegenstehenden Vorschriften nunmehr an sich verfassungswidrig. Eine Anregung des Abg. Dr. Süsterhenn (CDU) in der zweiten Lesung des Hauptausschusses (39. Sitzung), diese Folgerung dadurch abzuschwächen und der Gefahr eines Rechts-Chaos dadurch zu begegnen, daß bestimmt würde, die entgegenstehenden Vorschriften über die Stellung der Frau seien bis zum 31. März 1953 anzupassen, fand keinen Anklang Es wurde darauf hingewiesen, daß dann umgekehrt unter Umständen alles beim Alten und die Normierung einer derartigen Verpflichtung lediglich theoretisch bleibe, weil der Gesetzgeber nicht zu ihrer Erfüllung gezwungen werden könne. Es mußte deshalb vorgeschrieben werden, daß entgegenstehendes Recht zwar vorerst (limitiert) aufrecht erhalten wird, aber zu einem bestimmten Zeitpunkt außer Kraft tritt. Es bleibt nunmehr dem Gesetzgeber nichts anderes übrig, als rechtzeitig an die notwendige Rechtsreform heranzugehen. Mit Rücksicht auf die Schwierigkeit der Rechtsangleichung, vor allem auf weiten Gebieten des Familienrechts, entschloß man sich zu einer Frist von vier Jahren; die von der Abg. Dr. Selbert (SPD) im Organisationsausschuß (30. Sitzung) vorgeschlagene Frist von zwei Jahren wurde überwiegend als nicht ausreichend angesehen. Darüber hinaus wies der Abg. Dr. Becker (FDP) (in der 39. Sitzung des Hauptausschusses) darauf hin, daß es zweifelhaft sei, ob die gestellte Aufgabe bis zum Jahre 1953 in vollem Umfang erfüllt und durchgeführt werden könne. Er gab zu Protokoll, daß, wenn in einem künftigen Gebiet die Anpassung des Rechts erfolgt sei, andere, möglicherweise anzupassende Bestimmungen aber noch nicht angepaßt seien, damit der verfassungsrechtlichen Vorschrift Genüge getan sei.
Bereits in der 17. Sitzung des Hauptausschusses hatte der Abg. Dr. Becker (FDP) darauf hingewiesen, daß die Durchführung der Gleichberechtigung gerade nach der bürgerlich-rechtlichen Seite eingehendste Ueberlegungen erforderlich mache, z. B. in der Richtung, ob die Einführung der Errungenschaftsgemeinschaft als gesetzlicher Güterstand zu erstreben sei. Zu klären sei die Frage der Namensführung für Mann und Frau und für die Kinder, die Frage der elterlichen Gewalt. Welche Meinung gehe in Fällen der Nichtübereinstimmung vor? Müsse das Vormundschaftsgericht entscheiden? Weiter erhebt sich die Frage: wie ist es mit der Entscheidung über den gemeinschaftlichen Wohnsitz oder über die Art der Erziehung und Ausbildung der Kinder?
Daß die Gleichberechtigung der Frau auch die Innehaltung des Satzes einschließt „Gleicher Lohn bei gleicher Arbeit“ ist u. a. in der Sitzung des Hauptausschusses vom 18. 1. 1949 protokollarisch festgehalten worden.
b) Absatz 2 (Aufrechterhaltung von Einschränkungen des Grundrechts auf Freizügigkeit aus Gründen der Raum-Not):
Diese Vorschrift geht zurück auf einen Vorschlag des Vorsitzenden des Grundsatzausschusses, der lautete:
Gesetze, welche das Grundreeht der Freizügigkeit einschränken, bleiben bis zum 31. Dezember 1951 zulässig.
Die Freizügigkeit, für die im Herrenchiemseer Entwurf eine Vorschrift fehlte, ist in Artikel 11 des Grundgesetzes als Grundrecht normiert; in seinem Absatz 2 ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine Einschränkung dieses Grundrechtes möglich ist. Darüberhinaus mußte zum Ausdruck gebracht werden, daß das Recht der Freizügigkeit mit Rücksicht auf die besonderen Gegebenheiten der gegenwärtigen Notlage z. Zt. überhaupt nur in einem beschränkten Umfange gewährt werden kann. Diesem Zweck dient die in den Uebergangsvorschriften getroffene Regelung.
Im Hinblick darauf, daß die Dauer der vorausgesetzten Notlage nicht abzusehen sei, wurde vom Organisationsausschuß (in seiner 27. Sitzung) die Befristung gestrichen und die Formulierung gewählt:
Gesetze, welche das Grundrecht der Freizügigkeit einschränken, bleiben bis auf weiteres zulässig. Die volle Freizügigkeit gemäß Artikel 11 kann durch einfaches Bundesgesetz hergestellt werden.
Dazu wurde von dem Abg. Dr. Katz (SPD) erklärt: „Damit sind auch künftige Gesetze gedeckt. Es könnte übermorgen noch ein Landesgesetz in dieser Richtung verkündet werden“. Diese Fassung wurde vom Hauptausschuß in erster Lesung (20. Sitzung) gutgeheißen.
Der Redaktionsausschuß war dazu der Meinung, daß einerseits zwar die gegenwärtige Notlage sich hauptsächlich in der Raum-Not manifestiere, daß aber andererseits diese Raum-Not nicht unter allen Umständen als eine nur „vorübergehende“ Erscheinung angesprochen werden könne. Er wollte deshalb die Raum-Not als einen selbständigen und allgemeinen Einschränkungsgrund in den Freizügigkeits-Artikel mit einbeziehen (Vorschlag vom 18.12.1948).
Der Organisationsausschuß wollte indes den zeitlich begrenzten Charakter der insoweit zu normierenden Einschränkung besonders klar herausgehoben wissen und hielt deshalb an einer besonderen Uebergangsbestimmung fest (30. Sitzung). Dabei wurde darauf hingewiesen, daß die Freizügigkeit zur ausschließlichen Gesetzgebung des Bundes gehöre und demgemäß grundsätzlich der Bund ein Gesetz beschließen müsse, das grundlegend die Einschränkung der Freizügigkeit regele. Deshalb wurden die Worte „bis auf weiteres“ ersetzt durch die Formulierung „bis zu einer Neuregelung durch Bundesgesetz“. Im übrigen blieb der Artikel unverändert. Die vorgeschlagene Nenfassung wurde vom Hauptausschuß in zweiter Lesung (39. Sitzung) gebilligt. Dazu wies der Redaktionsausschuß (Vorschlag vom 25.1.1949) darauf hin, wenn man schon eine durch Gründe der Raum-Not bedingte Beschränkung der Freizügigkeit nur als zeitlich begrenzt betrachten wolle, solle man folgerichtig auch nur die zur Zeit (seither) dieses Grundrecht einschränkenden gesetzlichen Bestimmungen vorerst, d. h. bis zu ihrer Aufhebung durch Bundesgesetz, in Kraft belassen. Der dementsprechend vom Redaktionsausschuß gemachte Vorschlag fand in den folgenden Sitzungen Annahme und ist schließlich Gesetz geworden. Daraus dürfte sich ergeben: neue Gesetze -es kommen nur Bundesgesetze in Frage -können aus Gründen der Raum-Not weder Beschränkungen der Freizügigkeit einführen noch bisher bestehende für weitere Zeit aufrecht erhalten, vielmehr nur eine Lockerung bzw. die endgültige Aufhebung bringen.
In der vierten Lesung (57. Sitzung) wurde im Hauptausschuß beschlossen, diese Bestimmung mit der vorhergehenden in einem Artikel zusammenzufassen.
8. Artikel 140 (Aufrechterhaltung der religions- und kirchenpolitischen Artikel der Weimarer Reichsverfassung):
Dem Hauptausschuß lag in erster Lesung (22. Sitzung) ein gemeinsamer Antrag der Fraktionen CDU/CSU, Zentrum und Deutsche Partei vom 29.11.1948 vor, eine Regelung des Verhältnisses zwischen Staat und Kirche durch einen entsprechenden Artikel vorzunehmen. Der Antrag (PR-321) besagte u. a.:
1. Die Kirchen werden in ihrer Bedeutung für die Wahrung und Festigung der religiösen und sittlichen Grundlage des menschlichen Lebens anerkannt. Es besteht keine Staatskirche.
2. Die Kirchen und Religionsgesellschaften ordnen ihre Angelegenheiten selbständig aus eigenem Recht. Sie haben das Recht, ihre Aemter ohne Mitwirkung des Staates und der politischen Gemeinden zu verleihen und zu entziehen.
3. Kirchen und Religionsgesellschaften sowie ihre Einrichtungen behalten, ohne deshalb einer besonderen Staatsaufsicht zu unterliegen, die Rechte von Körperschaften öffentl. Rechts, soweit sie diese bisher besaßen. Anderen sind die gleichen Rechte auf Antrag zu verleihen, wenn sie durch die Verfassung oder die Zahl ihrer Mitglieder die Gewähr der Dauer bieten. Bei der Ausübung des ihnen eigenen Rechts, Steuern zu erheben, können Kirchen und Religionsgesellschaften sich der staatlichen Steuerlisten bedienen.
4. Das Eigentum und andere Rechte der Kirchen und Religionsgesellschaften sowie ihrer Einrichtungen an ihren für Kultus, Unterrichts- und Wohltätigkeitszwecke bestimmten Anstalten, Stiftungen und sonstige Vermögen sowie das Recht zum Neuerwerb von Eigentum, auch von Grundbesitz, zur Erfüllung ihrer Aufgaben werden gewährleistet.
5. Die den Kirchen und Religionsgesellschaften gemäß Gesetz, Vertrag oder anderen Rechtstiteln zustehenden Leistungen des Staates, der politischen Gemeinden oder Gemeindeverbände können nur durch Vereinbarungen abgelöst werden.
6. Die von den Kirchen und Religionsgesellschaften oder ihren Organisationen unterhaltenen Wohlfahrts- und Erziehungseinrichtungen werden als gemeinnützig im Sinne der Steuergesetzgebung anerkannt
Dieser Antrag wurde mit den elf Stimmen der SPD, FDP und KPD gegen die zehn Stimmen der übrigen Parteien abgelehnt, angenommen dagegen ein Antrag des Abg. Dr. Süsterhenn (CDU), in dem es unter Ziffer 1 hieß:
Die Bestimmungen der Artikel 137, 138 Absatz 2, 139 und 141 der Deutschen Verfassung vom 11. August 1919 werden aufrecht erhalten.
Hierzu bemerkte der Redaktionsausschuß (Stellungnahme vom 16.12.1948), es erscheine gesetzestechnisch bedenklich, daß durch diese Vorschriften einige wenige bestimmte Vorschriften aufrecht erhalten würden in Form einer Bezugnahme. Es sei zweckmäßiger, Inhalt und Wortlaut in das Grundgesetz aufzunehmen. Auch überschnitten sich diese Vorschriften zum Teil mit Bestimmungen des Grundgesetzes. Weiter tauchte die Frage auf, ob die Artikel der Weimarer Verfassung als einfaches oder als Verfassungsrecht aufrecht erhalten werden sollten. Schließlich sei zweifelhaft, ob die erwähnten Vorschriften der Weimarer Verfassung noch in Kraft geblieben oder z. B. infolge Aushöhlung gegenstandslos geworden seien. Sachlich richtiger sei deshalb, von „Inkraftsetzung“ statt von „Aufrechterhaltung“ zu sprechen, ggf. solle formuliert werden:
Die Bestimmungen der Artikel…..sind geltendes Bundesverfassungsrecht.
Die geltend gemachten Bedenken wurden vom Organisationsausschuß (130. Sitzung) nicht geteilt. Insbesondere wurde betont, daß zwar eine Verweisung auf andere Rechtsvorschriften an sich nicht schön, im Zuge der Uebergangsbestimmungen aber immerhin tragbar sei. Außerdem wurde von dem Abg. Dr Süsterhenn (CDU) darauf hingewiesen, daß man vielfach eine derartige Verweisung einer Formulierung in extenso bewußt vorziehe. Es blieb dann bei der Fassung der ersten Lesung des Hauptausschusses.
In der zweiten Lesung befaßte sich der Hauptausschuß mit dieser Materie in zwei Sitzungen. In der 39. Sitzung befürwortete der Abg. Dr. Seebohm (DP) eine Bestimmung des Inhalts:
Die Kirchen ordnen ihre Angelegenheiten selbständig aus eigenem Recht.
Dadurch sollte klar zum Ausdruck kommen, daß die kirchliche Autonomie nicht in der staatlichen Rechtsordnung begründet, keine vom Staat verliehene, sondern eine ursprüngliche Autonomie sei. Demgegenüber wurde jedoch geltend gemacht, daß durch das Herausgreifen eines einzelnen Punktes das gesamte System der Verweisung gesprengt würde. Auf der anderen Seite trat der Abg. Dr. Bergsträßer (SPD) dafür ein, daß anstelle der Bezugnahme auf den Absatz 2 des Artikels 138 der Weimarer Verfassung eine solche auf den gesamten Artikel 188 treten solle. Dem wurde aber entgegengehalten, daß der Absatz 1 (Ablösung von staatlichen Leistungen an die Kirchen) mit der damals noch vorgesehenen Bestimmung über die Aufrechterhaltung der Länderkonkordate nicht in Einklang zu bringen sei. In der 46. Sitzung brachte insbesondere der Abg. Zinn (SPD), ausgehend von der Stellungnahme des Redaktionsausschusses, gegen den Beschluß der ersten Lesung erneut sachliche und gesetzestechnische Bedenken vor. Der Problemkreis deckte offensichtlich einen besonders neuralgischen Punkt in den Verfassungsberatungen auf. Eine Gefährdung des Verfassungswerks durch das Aufeinanderprallen anscheinend unüberbrückbarer Gegensätze wurde indes vermieden, indem eine Beschlußfassung ausgesetzt und der dritten Lesung vorbehalten wurde. Auf Vorschlag des Fünfer-Ausschusses wurde in der dritten Lesung des Hauptausschusses (51. Sitzung) gegen zwei Stimmen der Vorschrift in folgender Fassung zugestimmt:
Die Bestimmungen der Artikel 137, 138, 139 und 141…..werden aufrecht erhalten.
Der Redaktionsausschuß fügte den in Bezug genommenen Artikeln noch den Artikel 136 der Weimarer Verfassung hinzu und ersetzte die Wendung „werden aufrecht erhalten“ durch die Formulierung „sind Bestandteil dieses Grundgesetzes“ (Vorschlag vom 2.6.1949). In dieser Form wurde die umstrittene Vorschrift schließlich vom Hauptausschuß in seiner vierten Lesung (57. Sitzung) sowie vom Plenum gebilligt. Die rechtliche Bedeutung und Tragweite der zu Bestandteilen dieses Grundgesetzes erklärten Artikel der Weimarer Verfassung ist nicht richtig zu ermessen, wenn ihre Auslegung primär aus dem Blickpunkt der früheren Reichsverfassung erfolgen oder ihre Betrachtung isoliert vorgenommen würde. Sinn und Zweck, wie sie den Bestimmungen heute richtigerweise zukommt, ergibt sich vielmehr nur aus der Tatsache ihrer Einbettung in das gesamte Wertsystem des Grundgesetzes, ihres Einbezogenseins in den Rahmen der Gesamtentscheidung, dessen Ausdruck das Grundgesetz ist. Besonders klar ist aus dem Grundrechtsteil zu ersehen, wie sehr das Grundgesetz mitten aus dem Geist unserer Zeit heraus bestimmt und gestaltet ist. Er beweist -vor allem in der Unbedingtheit der Herausstellung des Wertes der Menschenwürde -eindeutig die Anerkennung rechtlich relevanter Gegebenheiten, die dem Staat gegenüber präexistent sind, unabhängig von jeder staatlichen Rechtssetzung. Diese Ueberwindung eines ausschließlich staatsbezogenen Denkens, die Abkehr von einer etatistischen Grundauffassung und dem Gedanken jeder Staatsomnipotenz muß die maßgebende Richtschnur bilden auch bei der Untersuchung der religions- und kirchenpolitischen Normen. Durch diese Tatsache bedingt kann sich ihr rechtlicher Gehalt heute erheblich anders darstellen, als er in der Zeit vor 1933 überwiegend aufgefaßt wurde.
Dafür einige Beispiele:
Der Staat beläßt bezw. erteilt gemäß Artikel 187 Absatz 5 Weimarer Verfassung bestimmten Religlonsgesellschaften -d. h. vor allem den christlichen Kirchen -den Status einer „Körperschaft des öffentlichen Rechts“. Es war nun allgemein anerkannt, daß die betreffenden Kirchen öffentlich-rechtliche Körperschaften im eigentlichen Sinne nicht sind, sofern man darunter juristische Personen versteht, die dem Staate organisch eingegliedert oder untergeordnet sind. Die Aufgaben der Kirchen sind keine staatlichen Aufgaben, nicht vom Staat übertragen, sondern ursprüngliche und eigene Aufgaben. Die Kirchen waren aber öffentlich-rechtliche Körperschaften in dem Sinne bzw. wurden in dem Sinne als öffentlich-rechtliche Körperschaften behandelt, daß ihnen der Staat für seinen Bereich eine öffentlich-rechtliche Sonderstellung einräumte, für die im allgemeinen kennzeichnend war: Anerkennung der kirchlichen Gewalt als obrigkeitliche Gewalt, der kirchlichen Aemter, Behörden und Beamten als öffentliche, des kirchlichen Rechts als Teil des staatlichen öffentlichen Rechts, ihrer Verfügungen als für die Mitglieder unmittelbar verbindlich, Gewährung des Verwaltungszwanges. Inhalt, Umfang und Voraussetzungen der öffentlichen Körperschaftsrechte und damit deren Art und Maß, im einzelnen zu bestimmen, war Sache der an den Rahmen des Reichsrechts gebundenen Landesgesetzgebung. Daraus wurde nun von der herrschenden Lehre gefolgert, die Kirchen unterlägen einer über die abgemeine Vereins- bzw. Religionsaufsicht weit hinausgehenden, alle ihre Lebensäußerungen erfassenden, besonderen Staatsaufsicht, in der gesteigerten Form der Kirchenhoheit (die besondere Staatsaufsicht wird neuerdings noch, unter Berufung auf Anschütz, akzeptiert von Nawiasky-Leusser, Kommentar zur bayerischen Verfassung S. 226). „Weil die Kirchen Korporationen des öffentllichen Rechts bleiben, deshalb muß auch fortbestehen die besonders geartete Staatsaufsicht über die Kirchen, die Kirchenhoheit . . . Die über die allgemeine Vereinsaufsicht hinausgehende Kirchenhoheit ist ein notwendiges Korrelat der den Kirchen staatlicherseits gewährten öffentlich-rechtlich gehobenen Stellung“ (Schön, zitiert bei Anschütz, Kommentar 1933 S. 637). Demgegenüber vertrat eine Minderheit, geführt von dem katholischen Staats- und Kirchenrechtler Ebers, den Standpunkt, die gesteigerte Aufsicht sei nicht die Auswirkung, nicht das Korrelat der öffentlich-rechtllichen Stellung, vielmehr sei die Unterordnung unter eine gesteigerte Staatsaufsicht, geschichtlich gesehen, nichts anderes gewesen als eine rechtlich selbständige Folge der früher vorhanden gewesenen Eigenschaft der Kirchen als Landeskirchen, d. h. des darin liegenden Verhältnisses besonderer Verbundenheit der Kirchen mit dem Staate. Die gesteigerte Staatsaufsicht sei jedoch nicht mehr zu vereinbaren mit dem Grundsatz „chiesa libera in stato libero“.
Diese Auffassung muß heute, auch nach Ablehnung des bereits erwähnten Antrages vom 29.11.1948, in dem dieser Gedanke besonders zum Ausdruck gebracht worden war, als die richtige angesehen werden. Das Grundgesetz geht im gesamten von der Vorstellung aus, daß dem Staat als solchen in der allgemeinen Wert-Skala kein Vorrang zukommt. Die Eigenständigkeit und Eigenwertigkeit der Kirchen, deren Rechtsordnungen vom Staate unabhängig und dem Staate gegenüber präexistent sind, schließt heute eine besondere Staatsaufsicht aus, auch dann, wenn sie, formal gesehen, die Eigenschaft sog. öffentlich-rechtlicher Körperschaften aufweisen. Die Ansicht von Anschütz: „Die Kirche ist auch nach heutigem Staatsrecht ein innerstaatlicher, dem Staat untergeordneter Verband“ (Kommentar 1933 S. 635), kann nicht mehr als zutreffend anerkannt werden. Vielmehr ist ihre Herrschaftsgewalt eine ursprüngliche Gewalt zu eigenem Recht. Die Erhebung zur öffentlich-rechtlichen Korporation bedeutet nicht Verleihung, sondern nur Anerkennung dieser Herrschafts- und damit der Gesetzgebungs- und Disziplinargewalt für den Bereich des Staates bzw. die Gewährung staatlichen Zwanges.
Ein weiteres Beispiel bietet Artikel 137 Absatz 3 der Weimarer Verfassung. Er regelt das religionsgesellschaftliche Selbstbestimmungsrecht. Der gegenständliche Umfang war sowohl in der Zeit vor 1918 wie unter der Weimarer Verfassung (insbesondere zwischen Staat und katholischer Kirche) streitig. Für die entsprechende Regelung der alten preußischen Verfassung von 1850 wurde z. B. von Anschütz die Auffassung vertreten, „eigene“ Angelegenheit einer Religionsgesellschaft sei nur das, was der Staat formell als solche bezeichne. Für den Rechtszustand unter der Weimarer Verfassung setzte sich hingegen in weitem Umfang die Auffassung durch, daß eigene Angelegenheit alles sei, was materiell „nach der Natur der Sache“ bzw. nach seiner Zweckbeziehung als solche anzusprechen sei. Gleichwohl engte eine weit verbreitete Lehrmeinung den Bereich des kirchlichen Selbstverwaltungsrechts in starkem Maße ein. Beispielsweise wurde der Satz 2 dieses Absatzes, der bestimmte: „Die Religionsgesellschaft verleiht ihre Aemter ohne Mitwirkung des Staates oder der bürgerlichen Gemeinde“ dahin ausgelegt, daß landesgesetzliche Bestimmungen, nach denen dem Staat das Recht des Einspruchs gegen die Verleihung von Kirchenämtern an bestimmte Personen zustand, nicht darunter fielen, weil Einspruchsrechte keine „Mitwirkungsrechte“ seien. Außerdem sei Satz 2 eine bloße Anweisung an den Gesetzgeber ohne derogatorische Kraft (vgl. Anschütz, S. 639/40). Heute muß dagegen -übrigens in Uebereinstimmung mit der überwiegenden Auffassung des Weimarer Verfassungsausschusses (vgl. Ebers in Nipperdey, Grundrechte . . . 2. Band S. 392) -angenommen werden, daß durch Satz 2 als aktuelle Rechtsnorm alle Ernennungs-, Wahl- und Vorschlagsrechte, soweit sie nicht auf besonderen Rechtstiteln (Patronat, Vertrag) beruhen, aber auch alle Einspruchs- oder Bestätigungsrechte aufgehoben sind.
Zu beachten ist weiter, daß, soweit das Grundgesetz selbst durch eine an anderer Stelle -sei es im Grundrechtsteil oder anderwärts -vorgenommene Formulierung den rechtlichen Gehalt eines Rechtsgedankens der Artikel 136 ff. der Weimarer Verfassung in erkennbarer Weise verstärken will, die entsprechenden Vorschriften der früheren Reichsverfassung durch die einschlägige anderweitige Regelung ergänzt und damit erweitert („überhöht“) werden. Soweit die Weimarer Verfassungsartikel zu anderen Bestimmungen des Grundgesetzes in Widerspruch stehen, gehen letztere vor, und erstere sind nicht mehr auwendbar.
Zunächst sei der zuletzt genannte Fall an einem Beispiel erläutert:
Artikel 136 W.V. besagt: Die bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten werden durch die Ausübung der Religlonsfreiheit weder bedingt noch beschränkt. Dazu wurde, soweit auf Grund dieser Bestimmung die bürgerlichen und staatsbürgerlichen Pflichten durch die Religionsfreiheit nicht „beschränkt“ sein sollen, gelehrt, insofern decke sich die Vorschrift mit dem Artikel 12 Satz 3 der preußischen Verfassung von 1850: „Den bürgerlichen und staatsbürgerlichen Pflichten darf durch die Ausübung der Religlonsfreiheit kein Abbruch geschehen“, sowie mit Artikel 135 Satz 3 der W. V.: „Die allgemeinen Staatsgesetze bleiben unberührt“ (vgl. Poetzsch-Hefter, Handkommentar 1928 S. 444). Danach war also „die Religionsfreiheit durch die allgemeinen Staatsgesetze und die auf ihnen beruhenden Pflichten beschränkt, nicht umgekehrt“ (so Anschütz, Kommentar S. 623).
Dagegen hat der jetzige Verfassungsgesetzgeber die Unverletzlichkeit der Religionsfreiheit und die Gewährleistung der ungestörten Religionsausübung in Artikel 4 Absatz 2 des Grundgesetzes in unbedingter Form ohne Statuierung irgendeiner dem Artikel 135 Satz 3 der W. V. entsprechenden Einschränkung ausgesprochen. Das deckt sich mit der allgemeinen Tendenz des Grundrechtsabschnittes nach einer wirklich wirksamen Verbürgung der Persönlichkeits- und Freiheitsrechte. Deshalb sieht das Grundgesetz auch nicht, wie der Herrenchiemseer Entwurf und z. B. die bayerische Verfassung, eine generelle Ermächtigung an den Gesetzgeber vor, die Grundrechte durch Gesetz einzuschränken, wenn die öffentliche Sicherheit, Sittlichkeit oder Gesundheit es zwingend erfordert. Ebenso wenig ist der Vorschlag von Herrenchiemsee übernommen worden, daß die Grundrechte sich nur „im Rahmen der allgemeinen Rechtsordnung“ verstehen sollen. Angesichts dieser eindeutigen Grundhaltung geht es auch nicht an, in die im Grundgesetz fixierten Grundrechte und zumal in das Recht der freien Religionsausübung ungeschriebene, allgemeine immanente Schranken -eben in Gestalt aller sogn. allgemeinen Staatsgesetze schlechthin -hineinzulegen. Das ist für den Weimarer Verfassungszustand in sehr pointierter Weise von Anschütz mit den Worten geschehen: „Der dritte Satz (Artikel 135) spricht aus, was auch ohnedies gelten würde: die Religionsfreiheit findet in allen ihren einzelnen Bestätigungsmöglichkeiten ihre Schranke in den Staatsgesetzen. Staatsgesetz geht vor Religionsgebot. Was die Staatsgesetze als staatsgefährlich, sicherheits- oder sittenwidrig, ordnungswidrig oder aus sonst einem Grunde verbieten, wird nicht dadurch erlaubt, daß es in Ausübung einer religiösen Ueberzeugung geschieht“ (vgl. Anschütz, S. 621). Aehnlich wollen auch Nawiasky-Leusser (Kommentar zur Bayerischen Verfassung S. 181) im Bereich der Grundrechte die Erheblichkeit nicht ausdrücklich genannter Schranken dann bejahen, wenn sie dem „Wesen“ des betreffenden Grundrechts „inhärent“ und daher mit diesem mitgedacht seien. Der Reichsdisziplinarhof hat (Schulze-Simons, Die Rechtsprechung des Reichsdisziplinarhofs, Bln. 1926 S. 204 in einer Entscheidung vom 5.12.1921 die Auffassung vertreten, daß in jedem Falle die Grundrechte in dem besonderen Beamtenverhältnis ihre natürliche Grenze fänden. Ueberhaupt sollen nach seiner Auffassung „die Grundrechte da nicht gelten können, wo die Verhältnisse aus ihrer natürlichen Beschaffenheit das ausschließen“.
Wenn man indes bedenkt, daß -auch gerade nach der klar erkennbaren Absicht des Grundgesetzes -das Wesen der Grundrechte vor allem darin besteht, daß sie grundsätzlich als unbegrenzt zu denken sind, so kann man in all den Fällen, wo nicht unzweideutig zum Ausdruck gekommen ist, daß ein einzelnes Grundrecht eine engergezogene, ihm von vornherein innewohnende Schranke aufweisen soll oder, zwecks Ermöglichung von Eingriffen, ein Gesetzesvorbehalt besonders (einen allgemeinen Gesetzesvorbehalt kennt das Grundgesetz, wie erwähnt, nicht) ausgesprochen ist, nur ganz bestimmte, in Artikel 2 Absatz 1 umrissene Schranken anerkennen, nämlich: die Rechte anderer, die verfassungsmäßige Ordnung und das Sittengesetz. Diese, dem Recht der allgemeinen Handlungsfreiheit gezogenen Schranken gelten allerdings -mit Ausnahme des Rechts der Glaubens- und Gewissensfreiheit -für alle Grundrechte, schon aus dem Grunde, weil die in den folgenden Artikeln verbrieften Freiheitsrechte, von der vorerwähnten Ausnahme abgesehen, im Grunde nur eine Konkretisierung der in Artikel 2 Absatz 1 statuierten allgemeinen Freiheit sind.
Der Begriff „verfassungsmäßige Ordnung“ ist enger als z. B. der Begriff „Ordnung des Gemeinwesens“ in Artikel 2 Absatz 2 der württemberg-badischen Verfassung, in dem man u. a. eine generelle Vollmacht für ein Eingreifen der Polizei erblickt. Gestützt auf diese Vorschrift, heißt es in dem Kommentar zur württemberg-badischen Verfassung (herausgegeben von Nebinger, Stuttgart 1948), ein Mormone dürfe bei uns nicht für die Vielweiberei agitieren; ebenso wenig sei ein Vertreter der Christian Science geschützt, der chirurgische Operationen ablehne und die Gebetsheilung für den richtigen Weg halte. Vom Standpunkt des Grundgesetzes aus („Sittengesetz“) würde sich dagegen zwar der „Mormonenfall“ genau so darstellen, wohl kaum aber derienige des Christian ScienceVertreters (kein Verstoß gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz!)
Zusammenfassend ist zu sagen: Sofern nicht dabei jeweils die in Artikel 2 Absatz 1 normierten Schranken eingreifen, bildet ein Spezialgesetz überhaupt keine Schranke für das Recht auf freie Religionsausübung. Ein allgemeines Staatsgesetz bildet nur, unter ganz bestimmten Voraussetzungen eine Schranke, nämlich nur dann, wenn bzw. soweit es sich um eine allgemeine Vorschrift des staatlichen Rechts handelt, die den inhaltlichen Gehalt des in Frage stehenden religiösen Bekenntnisses überhaupt nicht tangiert, z. B. bau-, sicherheitspolizeiliche und ähnliche Vorschriften, Einrichtung der Zivilehe, Schaffung der Eidespflicht und der Schulpflicht an sich usw. Wo aber eine derartige Einwirkung vorliegt, geht das religlöse Bekenntnis und seine Ausübung vor. Besondere Schwierigkeiten hat z. B. in der Staatspraxis der Weimarer Zeit die Gewährleistung der freien Religionsausübung an staatlich nicht anerkannten kirchlichen Feiertagen (besondere Bußtage, Feiertage religiöser Minderheiten) bereitet, an denen das allgemeine Staatsgesetz den Schulbesuch der Kinder fordert. Wenn in solchen Fällen Befreiungen vom Schulbesuch zur Befriedigung eines religiösen Bedürfnisses gewährt wurden, so wollte man darin überwiegend ein bloß freiwilliges Entgegenkommen erblicken (Poetzsch-Hefter S. 444). Heute muß dagegen ein verfassungsmäßiges Recht auf derartige Befreiungen anerkannt werden. Deshalb kann z. B. die Schulversäumnis der Kinder von Adventisten, deren religiöse Ueberzeugung die Heilighaltung des Samstages gebietet, an diesem Tage nicht mehr als ein unberechtigter Verstoß gegen die staatliche Pflicht des Schulbesuches angesehen werden. Somit kann eine „staatsbürgerliche Pflicht“ unter Umständen sehr wohl durch das Recht auf freie Religionsausübung beschränkt werden. Soweit Artikel 136 Abs. 1 der W.V. dem entgegensteht, ist er also künftig nicht mehr anwendbar.
Als Beispiel für den Fall der Verstärkung des Rechtsgehaltes einer Vorschrift der Artikel 136 ff. der W.V. sei verwiesen auf Absatz 2 des Artikels 136, demzufolge u. a. die „Zulassung zu öffentlichen Aemtern“ unabhängig ist von dem religiösen Bekenntnis. Der Artikel 33 Abs. 3 des Grundgesetzes geht insofern über diese Vorschrift hinaus, als nach ihm außer der Zulassung zu öffentlichen Aemtern auch die „im öffentlichen Dienst erworbenen Rechte“ vom religiösen Bekenntnis unabhängig sind. Die Rechtsstellung der öffentlichen Bediensteten ist durch das Grundgesetz nach der bezeichneten Richtung damit erheblich verstärkt und manche frühere Zweifelsfrage durch diese eindeutige Formulierung abgeschnitten worden.
9. Artikel 141 (Clausula Bremensis):
Nach Artikel 7 Absatz 3 Satz 1 des Grundgesetzes ist der Religionsunterricht in den öffentlichen Schulen, mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen ordentliches Lehrfach. Er wird gemäß Satz 2 „in Uebereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften“ erteilt.
Bereits in der zweiten Lesung hatte der Hauptausschuß die Bestimmung beschlossen, daß der Religionsunterricht -die damalige Formulierung wählte den Weg der Einzelaufzählung -in den öffentlichen Volks-, Mittel- und Berufsschulen und in den höheren Lehranstalten ordentliches Lehrfach sei. Die Bestimmung fand in doppelter Beziehung Widerspruch: „Religionsunterricht“ soll nach den Intentionen des Verfassungsgesetzgebers -wie schon unter der Weimarer Verfassung, deren einschlägige Vorschrift bei der endgültigen Gesetzesfassung schließlich im Wortlaut übernommen wurde -nur sein ein bekenntnismäßig gebundener Unterricht: durch ihre Grundsätze, an die der Staat zumindest inhaltlich gebunden ist, entscheiden letztlich die Religlonsgemeinschaften über das „was“, den Lehrinhalt des Religionsunterrichtes. Dazu wurde darauf hingewiesen, daß die Verpflichtung zur Einführung eines in dieser Weise substantiell charakterisierten Religionsunterrichtes das Land Bremen in eine schwierige Situation bringe. Landesverfassungsrechtlich kennt Bremen einen derartigen -dogmatischen -Unterricht nicht. Vielmehr bestimmt Art. 32 der Bremer Verfassung vom 21.10.1947, indem er einen seit ca. 150 Jahren bestehenden Zustand verfassungerechtlich verankert, daß die allgemein bildenden öffentlichen Schulen Gemeinschaftsschulen mit bekenntnismäßig nicht-gebundenem Unterricht in biblischer Geschichte auf allgemein christlicher Grundlage sind. Allerdings konnte andererseits nicht übersehen werden, daß in der Weimarer Verfassung, die im Artikel 149 den Religionsunterricht für die Schulen des ganzen Reichsgebiets, mit Ausnahme der weltlichen Schulen obligatorisch gemacht hatte, der „Bremer Tradition“ auch kein Reservat belassen worden war. Zum andern wurde betont, daß es nicht angehe, durch die generelle Einbeziehung der Berufsschulen in den (jetzigen) Artikel 7 von bundesverfassungswegen eine entsprechende Verpflichtung auch für solche Länder zu schaffen, deren Recht bisher einen Religionsunterricht in den Berufsschulen nicht vorsehe.
Auf Grund vorangegangener interfraktioneller Besprechungen wurde dann vom Fünfer-Ausschuß (Vorschlag vom 5.2.1949) eine Uebergangsbestimmung folgenden Wortlauts angeregt: „Soweit am 1.1.1949 in einem Lande eine von den Vorschriften des (damaligen) Artikel 7b Absatz 2 abweichende landesgesetzliche Regelung in Kraft war, kann es bei dieser Regelung verbleiben“. Das war die Geburtsstunde der vielumstrittenen „Bremer Klausel“. Mit Recht hat man von ihr gesagt, die weltanschaulichen Gegensätze, mit denen das politische Leben in Deutschland anscheinend unentrinnbar belastet sei, hätten in dieser Formel ihren dichtesten Ausdruck gefunden (Die Neue Ordnung 1949 S. 261). Die Rückführung aller widerstrebenden Kräfte auf diesen einen Verfassungsartikel, eine anscheinend belanglose Uebergangsvorschrift, hätte, wie in der dritten Lesung des Hauptausschusses (51. Sitzung) offenbar wurde, fast zu einer Gefährdung des ganzen Verfassungswerks geführt.
In dieser Sitzung wies der Abg. Dr. Süsterhenn (CDU) darauf hin, daß seine politischen Freunde dem Artikel nicht zustimmen könnten, da er einen Uebergriff aus dem staatlichen in den kirchlichen Bereich sanktioniere. In ähnlichem Sinne äußerte sich der Abg. Brockmann (Z). Während der Abg. Dr. Heuß (FDP) den Artikel „wenn auch nicht gerade als ein Kernstück, so doch als ein wesentliches Element der interfraktionellen Abmachungen“ angesehen wissen wollte, wurde die Bestimmung von dem Abg. Dr. Menzel (SPD) als „entscheidender Bestandteil des Kompromisses“ bezeichnet und von ihm zweimal eine Unterbrechung der Sitzung angeregt.
Der Abg. Kaiser (CDU) wollte eine Klarstellung dahin, daß der Artikel sich nur auf die verfassungsrechtliche Bestimmung von Bremen und auf kein anderes Land beziehe. Nachdem der Abg. Dr. Suhr (SPD) geltend gemacht hatte, die Bestimmung gelte nach ihrer Formulierung nicht nur für Bremen, sonden für alle Länder, die davon betroffen würden, wies der Abg. Kaiser (CDU) „um der Klarheit und um der Wichtigkeit der Angelegenheit willen“ nochmals darauf hin, der Artikel sei lediglich unter Hinweis auf einen außerordentlichen oder außergewöhnlichen verfassungsrechtlichen Zustand in Bremen zustande gekommen. Der Abg. Dr. Heuß (FDP) führte aus, der Artikel gehe auf eine Anregung zurück, die er gemacht habe, weil die im Grundrechtsteil in der Frage des Religionsunterrichtes im allgemeinen wie seiner Erteilung in den Berufsschulen im besonderen getroffene Regelung von seiten der Bremer und Hamburger als eine für sie besonders komplizierte Angelegenheit bezeichnet worden sei…..“Soweit Bremen in Frage kommt, handelt es sich nicht lediglich um die verfassungsrechtliche Formulierung, sondern Bremen hat -geistesgeschichtlich besonders interessant -eine für sich geschlossene Tradition ….“. Der Abg. Dr. Menzel (SPD) entgegnete auf die Darstellung des Abg. Kaiser (CDU): „Als Mitglied des Fünfer-Ausschusses muß ich den Feststellungen des Herrn Kollegen Kaiser widersprechen. Es ist richtig, daß wir bei den Beratungen im Fünfer-Ausschuß zunächst den Fall Bremen behandelt haben. Dann haben Abgeordnete aus dem Gebiet Hamburg uns erklärt, daß bei ihnen die gleichen Bedingungen gegeben seien, dann kam Hessen und hat ebenfalls erklärt, daß es auf diese Vorschriften Wert legt. Es ist nicht so, daß mit dieser Bestimmung nur der Fall Bremen erledigt werden sollte“. Demgegenüber blieb der Abg. Kaiser (CDU) bei seiner Darstellung: „Im interfraktionellen Ausschuß war, als die Sache zustande gekommen ist, ausschließlich von Bremen die Rede. Meine politischen Freunde haben sich mit der Sache schließlich abgefunden, damit es überhaupt zu einer Formulierung kam. Es war der Name Bremen zunächst in die Formulierung aufgenommen worden und ist nur nach dem Hinweis darauf, daß das nicht in das Grundgesetz paßt, fallen gelassen worden“.
Nachdem ein Antrag des Abg. Dr. Lehr (CDU) auf Zurückverweisung an den Fünfer-Ausschuß mit dreizehn gegen acht Stimmen abgelehnt worden war, wurde der Artikel schließlich mit zwölf gegen sechs Stimmen angenommen. Im Anschluß daran bemerkte der Abg. Dr. von Brentano (CDU) in einer persönlichen Erklärung, daß, als er seine Unterschrift unter den entsprechenden Vorschlag des Fünfer-Ausschusses gesetzt habe, eindeutig vom Fall Bremen die Rede gewesen sei.
Der Redaktionsausschuß schlug für die vierte Lesung des Hauptausschusses eine redaktionell etwas abgeänderte Fassung folgenden Wortlauts vor: „Soweit am 1. Januar 1949 in einem Lande der Bundesrepublik eine von der Vorschrift des Artikels 7b Absatz 3 abweichende landesrechtliche Regelung in Kraft war, kann es bei dieser Regelung verbleiben“. Die zutage getretenen, weltanschaulich bedingten Gegensätze der verschiedenen Auffassungen ließen es angezeigt erscheinen, den durch das Stichwort „Bremer Klausel“ umrissenen Fragenkreis nicht zum Gegenstand der der vierten Lesung voraufgegangenen, in größerem Kreise geführten interfraktionellen Besprechungen zu machen, sondern seine Behandlung, ebenso wie die der damit im inneren Zusammenhang stehenden Grundrechtsartilkel – damals Artikel 7a und 7b -, einer Sonderbesprechung einiger weniger ausgesuchter Experten der CDU/CSU,SPD und FDP zu überlassen. Auf Anregung des Präsidenten wurden dazu bestimmt die Abgeordneten Dr. Süsterhenn (CDU), Zinn (SPD) und Dr. Dehler (FDP).
In diesen Beratungen -am 4. Mai 1949 -kam man zu dem Ergebnis, daß zwar in den besonders strittigen Einzelfragen, wie Elternrecht, Bremer Klausel, eine einhellige Auffassung nicht zu erzielen und insoweit eine unbedingte Bindung der Beteiligten bzw. ihrer Parteien an jeweils eine Formulierung nicht möglich sei, sondern die Entscheidung im einzelnen nach den einmal gegebenen und bekannten Mehrheitsverhältnissen getroffen werden solle, daß aber die jeweils überstimmten daraus keine „Kabinettsfrage“ machen würden, und ihre Zustimmung im gesamten davon unabhängig sein würde. Außerdem wurde die juristische Tragweite der einzelnen in Frage stehenden Formulierungen fixiert.
Danach ist es einmal nicht zweifelhaft, daß Artikel 7 Absatz 3 als unmittelbar geltendes Recht eine wirklich effektive, unbedingt verpflichtende Gewährleistung des Religionsunterrichtes als ordentliches Lehrfach für alle öffentlichen Schulen darstellt, mit der einzigen Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen. Der Begriff öffentliche, „bekenntnisfreie“ Schulen ist nicht weiter als der entsprechende Begriff in Art.149, 146 Abs. 2 der Weim. Verfassung, wo er zum erstenmal geprägt worden ist; d. h. es fal!en darunter ausschließlich nur solche öffentlichen Schulen, (Volksschulen), die ggf. auf Antrag (von Erziehungsberechtigten) eingerichtet werden. Es wäre ein glatter Verstoß gegen diese Verfassungsbestimmung bzw. ein unzulässiger Umgehungsversuch, wenn etwa ein Land es unternehmen würde, im Wege der Landesgesetzgebung „bekenntnisfreie“ Schulen als staatliche Regelschulen einzuführen bzw. aufrecht zu erhalten. In jedem Falle kann die bekenntnisfreie Schule nur neben anderen staatlichen Schularten, sei es Bekenntnisschule, sei es Gemeinschaftsschule, oder seien es beide, bestehen.
Deshalb wird auch die Bremer (Regel-)Schule mit ihrem simultanen, biblischen Geschichtsunterricht durch den Begriff „bekenntnisfreie Schule“ im Sinne des Artikels 7 Absatz 3 nicht gedeckt; sie ist, unter dem Blickpunkt des Artikels 7 Absatz 3, an sich zweifellos verfassungswidrig. Insofern gibt die Bemerkung in dem amtlichen Bericht des Abg. Dr. von Mangoldt: „Da es sich bei den Bremer Schulen aber, ihrem Charakter nach, um weltliche Schulen handelt, kommt diesem Satz -gemeint ist die „Bremer Klausel“! -jetzt eine Bedeutung nicht mehr zu“, die Rechtslage nicht zutreffend wieder. Nur durch eine Bestimmung nach Art der Klausel konnte die sonst gegebene Verfassungswidrigkeit paralysiert werden.
Zum zweiten erstreckt sich die verfassungsmäßige Gewährleistung auch auf die Berufsschulen. Gestützt auf die Entstehungsgeschichte wurde unter der Weimarer Verfassung vereinzelt der Standpunkt vertreten, in diesen Schulen sei der Religionsunterricht nur dort ordentliches Lehrfach, wo er durch besonderes Gesetz eingeführt werde. Der in das Grundgesetz nicht aufgenommene Satz „Seine Erteilung wird im Rahmen der Schulgesetzgebung geregelt“ wurde dementsprechend von den Verfechtern dieser Auffassung dahin ausgelegt, daß die Schulgesetzgebung nicht bloß bestimme, wie, sondern auch ob er erteilt werde (vgl. Poetzsch-Hefter, Handkommentar 1928 S. 476/ 477). Ein Erlaß des preußischen Ministers für Handel und Gewerbe vom 11.3.1929 beurteilte, unter Bezugnahme auf einen Ministerialerlaß von 1897, die Rechtslage in der gleichen Weise. Dieser Standpunkt ist heute nicht mehr haltbar. Wenn anstelle der noch in dritter Lesung vom Hauptausschuß beschlossenen, die Berufsschulen ausdrücklich mit einbeziehenden Einzelaufzählung schließlich die generelle Formel „öffentliche Schulen“ getreten ist, so sollte damit -politisch-taktisch bedingt: zwar weniger pointiert in der Form, doch nicht weniger präzise in der Sache -für den sachlichen Geltungsbereich des Artikels 7 Absatz 3 keine Einschränkung vorgenommen, sondern nur bestimmten, bis dahin widerstrebenden Kräften eine Zustimmung erleichtert bzw. zumindest die bisherige Gegnerschaft gedämpft werden.
Eine bedeutsame Einschränkung des in Artikel 7 Absatz 3 normierten Rechtsgrundsatzes, und zwar seines örtlichen Geltungsbereiches, bedeutet dagegen, politisch-weltanschaulich bedingt -diese Zweckbestimmung hat sich nicht gewandelt -eben die „Bremer Klausel“. Die endgültige Formulierung der Klausel -sie wurde in der vierten Lesung (57. Sitzung) dem Hauptausschuß von dem Abg. Zinn (SPD) zugleich im Namen des Abg. Dr. Dehler (FDP) vorgelegt, sowie eine von dem Berichterstatter Abg. Dr. v. Brentano (CDU) in der zweiten Sitzung des Plenums dazu abgegebene erläuternde Erklärung sind das Ergebnis der erwähnten Experten-Besprechung. Die Klausel findet Anwendung in allen Fällen, wo nach dem zu dem angegebenen Stichtermin in einem Lande bestebenden Rechtszustand für mindestens eine Schulgattung des öffentlichen Schulwesens ein Religionsunterricht nicht vorgesehen ist; d. h. unter die Klausel fallen also einmal alle diejenigen Länder, die einen -bekenntnismäßig gebundenen -Religionsunterricht in ihren öffentlichen Schulen überhaupt nicht kennen, zum zweiten aber auch alle diejenigen, wo speziell die Berufsschulen davon ausgenommen sind. Im ersteren Falle braucht in keiner öffentlichen Schule, insbesondere in keiner Volksschule, dieser Unterricht eingeführt zu werden, im letzteren Falle in den Berufsschulen nicht. Die „andere landesrechtliche Regelung“ braucht nicht auf formellem Gesetz zu beruhen und erst recht nicht landesverfassungsrechtlicher Art zu sein. Schon daraus ergibt sich, daß der Anwendungsbereich der Formel nicht auf das Land Bremen beschränkt ist. In der 57. Sitzung des Hauptausschusses wurde ein mit einem gleichlautenden Antrag des Zentrums gestellter Antrag des Abg. Dr. Seebohm (DP) auf Streichung der Klausel bei einem Stimmenverhältnis von acht zu zehn Stimmen abgelehnt, dagegen die von dem Abg. Zinn (SPD) beantragte Fassung mit elf gegen zwei Stimmen bei mehreren Stimmenthaltungen der CDU/CSU angenommen.
Der Streichungsantrag Dr. Seebohm (DP)-Brockmann (Z) wurde in der zweiten Lesung des Plenums wiederholt, jedoch wiederum abgelehnt. Der Abg. Dr. Seebohm (DP) hatte insbesondere darauf hingewiesen, die Einschränkung eines Grundrechts in einem Uebergangsartikel sei in sich widersinnig, während der Abg. Brockmann (Z) geltend machte, die praktische Bedeutung des Artikels 7 Absatz 3 müsse gerade darin gesehen werden, daß er für die Länder gelte, in denen der Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach keine landesrechtliche Regelung erfahren habe.
Die „Bremer Klausel“ hebe deshalb im Grunde genommen das auf, was Art. 7 Absatz 3 geben wolle. Indes wurde die Klausel in der gleichen Fassung wie in der vierten Lesung im Hauptausschuß vom Plenum angenommen. Zuvor hatte der Abg. Dr. v. Brentano (CDU) erklärt: „Als Berichterstatter habe ich zu Art. 142 folgende Erläuterung zu geben. Unter einer landesrechtlichen Regelung in einem Lande im Sinne dieses Art. ist nicht nur eine einheitliche Regelung zu verstehen, sondern es kann sich auch um eine differenzierte Regelung handeln. Im Wege der Landesregelung kann nach diesem Artikel der Religionsunterricht auch dort, wo er am 1. Januar 1949 nicht ordentliches Lehrfach war, zum ordentlichen Lehrfach erklärt werden. Diese so getroffene Regelung kann im Wege der Landesgesetzgebung wieder geändert werden“.
Die „Bremer Klausel“ findet also auch Anwendung, wenn die „andere landesrechtliche Regelung“ nicht in dem Gesamtgebiet eines Landes gilt oder gelten würde (z. B. im Falle der Bildung eines größeren Landes aus mehreren früheren Einzelländern). Auf der anderen Seite erschien es untragbar -darin liegt eine wichtige Aenderung (Milderung) gegenüber den ursprünglichen Vorschlägen -, den von der „Bremer Klausel“ umfaßten Rechtszustand ein für alle Mal von bundesverfassungswegen zu sanktionieren. Es soll vielmehr ausschließlich den zuständigen Landesorganen überlassen bleiben, im Rahmen des jeweiligen Landesrechtes darüber zu befinden, ob und wie ggf. einem geänderten Mehrheitswillen Rechnung zu tragen und eine dem Grundsatz des Artikels 7 Absatz 3 entsprechende Regelung von landeswegen zu treffen ist. Die als Folge des verlorenen Krieges eingetretenen und immer noch nicht zum Abschluß gelangten Bevölkerungsverschiebungen insbesondere lassen es als durchaus möglich erscheinen, daß auch in den unter die „Bremer Klausel“ fallenden Ländern über kurz oder lang Bevölkerungskreise eine beachtliche Stärke gewinnen, die nach ihrer religiösen Ueberzeugung zumindest einen obligatorischen Religionsunterricht für unbedingt erforderlich halten. In Fällen solcher Art z. B. müssen die nach Landesrecht gegebenen Möglichkeiten genutzt werden können; auf landesrechtlicher Basis diesem Willen Geltung zu verschaffen.
10. Artikel 142 (Inkraftbleiben von Grundrechten der Landesverfassungen):
In Uebereinstimmung mit Artikel 13 Absatz 1 der Weimarer Verfassung bestimmt der Art. 31 des Grundgesetzes „Bundesrecht bricht Landesrecht“. Dazu führte in der dritten Lesung des Hauptausschusses (51. Sitzung) im Auftrage des Fünfer-Ausschusses der Abg. Dr. von Brentano (CDU) u. a. aus: „. . . Ueber den Grundsatz, daß Bundesrecht Landesrecht bricht, besteht weder im Hauptausschuß noch im Fünfer-Ausschuß Meinungsverschiedenheit. Wir wollten von diesem Wortlaut, der uns von der Weimarer Verfassung überkommen ist und einen festumrissenen Inhalt hat, weder abgehen noch ihn einschränken . . .“. Dieser „festumrissene Inhalt“ aber bedeutet (nach der Formulierung von Anschütz, Kommentar 1933 S. 103), „daß durch den Erlaß eines Bundesgesetzes alles dessen Gegenstand betreffenden Landesrecht aufgehoben und die Entstehung neuen Landesrechts über diesen Gegenständ ausgeschlossen wird. Das Bundesgesetz wirkt mithin nach rückwärts als Aufhebung, nach vorwärts als Sperre. Im einzelnen gilt:
a. die Aufhebung bedeutet volle Vernichtung des Landesrechts, nicht etwa bloß eine zeitlich bedingte Außerkraftsetzung. Derogation ist mehr als Suspension…..
b. die Aufhebung erstreckt sich auf alle den Gegenstand (den sachlichen Geltungsbereich) des Bundesgesetzes betrelfende Normen des Landesrechts, ohne Unterschied der Form (einfaches Gesetz, Verfassungsgesetz, Verordnung, Gewohnheitsrecht) und des Inhalts: Landesgesetze, die mit dem Bundesgesetz inhaltlich übereinstimmen, verfallen der Aufhebung nicht minder als solche, welche dem Bundesgesetz widersprechen“.
Wiederholt hatte jedoch vor allem der Abg. Dr. Laforet (CSU) zu bedenken gegeben, daß es nicht richtig sei, wenn in allen Fällen und unter allen Umständen Bestimmungen der Landesverfassungen, die inhaltlich mit denen des Grundgesetzes übereinstimmen, außer Kraft träten. Vor allem dieser Erwägung entsprang der in der vierten Lesung des Hauptausschusses (57. Sitzung) gestellte Antrag der Abgeordneten Dr. Pfeiffer, Dr. von Brentano, Dr. Laforet und Hilbert (CDU/CSU), den Satz „Bundesrecht bricht Landesrecht“ zu ersetzen durch die Fassung „Bundesrecht geht vor Landesrecht“. Der Antrag wurde mit elf gegen zehn Stimmen abgelehnt.
Es herrschte aber weitgehend Uebereinstimmung darüber, daß der Anregung des Abg. Dr. Laforet (CSU) auf dem Gebiet der Grundrechte Rechnung zu tragen sei. Andernfalls wäre z. B. -vom Standpunkt der herrschenden Rechtsauffassung aus -ein besonders bedeutsames Kernstück des bayerischen Verfassungswerks, die sogen. Verfassungsbeschwerde, weithin illusorisch geworden. Mit dieser Beschwerde kann die Verletzung subjektiver, in der bayerisehen Verfassung selbst oder in einem Anhang zu dieser (Artikel 75 Absatz 4) vorgesehener Rechte angefochten werden, insbesondere also die Verletzung von Grundrechten. Wenn nun aber nicht nur bei Vorliegen eines Widerspruchs, sondern auch in allen Fällen inhaltlicher Uebereinstimmung die in der bayerischen Verfassungsurkunde gewährleisteten Grundrechte denienigen des Grundgesetzes hätten weichen müssen, wäre insoweit kein Raum mehr gewesen für die Verfassungsbeschwerde, die mit der Verletzung eines im Grundgesetz gewährleisteten Grundrechts nicht begründet zu werden vermag.
Im Hinblick auf Konsequenzen dieser Art schuf der Hauptausschuß in dritter Lesung (51. Sitzung) auf Vorschlag des Fünfer-Ausschusses eine Bestimmung folgenden Wortlauts:
Die Artikel 1 bis 20b -das waren die damaligen Grundrechtsartikel -stehen Bestimmungen gleichen Inhalts in den Länderverfassungen nicht entgegen.
Diese Formulierung war indes rechtslogisch nicht glücklich, da eine höher-rangige Norm niemals einer Norm niederen Ranges „entgegensteht“, sondern -umgekehrt -immer nur eine niedere der höherwertigen, wie auch jedes Grundrecht einer Länderverfassung jeweils nur eine geringere Gewährleistung bietet als das Bundesgesetz. Diesem Umstand wurde die von dem Vorsitzenden des Redaktionsausschusses, dem Abg. Zinn (SPD), in der vierten Lesung (57. Sitzung) des Hauptausschusses vorgeschlagene Nenfassung gerecht, die auch endgültiger Gesetzestext geworden ist.
Durch die nunmehrige Fassung ist klargestellt, daß Bestimmungen der Länderverfassungen nicht mehr gelten, soweit sie eine Grundrechtsgewährleistung gegenüber dem Grundgesetz einschränken. Dafür ein Beispiel: nach Artikel 8 Absatz 2 des Grundgesetzes kann das Recht der Versammlungsfreiheit für Versammlungen unter freiem Himmel durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes beschränkt werden. Dieser Absatz enthielt -in Uebereinstimmung mit der Weimarer Regelung -ursprünglich noch einen zweiten Satz, der für Versammlungen unter freiem Himmel bei „unmittelbarer Gefahr für die öffentliche Sicherheit“ die Möglichkeit eines Verbotes vorsah; er fiel endgültig in der vierten Lesung des Hauptausschusses. Der Verfassungsgesetzgeber hat es also abgelehnt, der Polizei insoweit ohne weiteres die Möglichkeit von Präventiv-Verboten -und damit auch das Recht zur Auflösung von Versammlungen -zu geben. Auf Grund der Verbotsbestimmung der Weimarer Verfassung waren nicht nur Verbote von Fall zu Fall gegen bestimmte einzelne Versammlungen erlassen worden. Vielmehr hatte es die Verwaltungspraxis z. B. in Preußen, Bayern und Baden für zulässig gehalten, Verbote allgemein für längere Zeit und mit Wirkung für das ganze Land zu erlassen. Dem allen sollte ein Ende gemacht werden. Die Folge ist, nach der Darstellung des Berichtes des Abg. Dr. von Mangoldt: „Soweit z. Zt. nicht Gesetze in Kraft sind, die zum Einschreiten gegen Versammlungen unter freiem Himmel ermächtigen, besteht bis zum Inkrafttreten des vorgesehenen Gesetzes, also für eine sicherlich nicht unerhebliche Zeitspanne, keine Möglichkeit, Versammlungen unter freiem Himmel auch bei unmittelbarer Gefahr für die öffentliche Sichetheit, also selbst dann, wenn schwerste Schäden für das Gemeinwesen drohen, zu verbieten!“ Es kann deshalb keinem Zweifel unterliegen, daß z. B. Artikel 14 Absatz 2 der württembergisch-badischen Verfassung, in dem die für das Grundgesetz abgelehnte Verbotsklausel sich findet und der damit -generell, ohne Erfordernis einer besonderen gesetzlichen Grundlage -die unmittelbare Möglichkeit von Präventiv-Verboten für die Polizei schafft, nicht mehr gilt.
Durch das Wörtchen „auch“ sollte zum Ausdruck kommen, daß neben den mit diesem Grundgesetz inhaltlich übereinstimmenden erst recht -nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen -solche Vorschriften der Länderverfassungen in Kraft bleiben, die über den Rahmen des Grundgesetzes hinaus einen stärkeren Grundrechtsschutz oder weitere im GG nicht aufgeführte Grundrechte gewährleisten. „Der Grundrechtskatalog des GG ist ein Minimum, über das die Länderverfassungen hinausgehen können und hinausgegangen sind“. (Dennewitz „Die Oeff. Verwaltung“ 1945, 342).
Hinzuweisen ist noch darauf, daß das an den Präsidenten des Parlamentarischen Rates gerichtete Genehmigungsschreiben der Militärgouverneure vom 12. Mai 1949 unter Ziffer 8 lautet:
Um die Möglichkeit zukünftiger Rechtsstreitigkeiten auszuschalten, möchten wir klarstellen, daß wir bei der Genehmigung der Verfassung für die Länder bestimmten, daß nichts in diesen Verfassungen als Beschränkung der Bestimmungen der Bundesverfassung ausgelegt werden kann. Ein Konflikt zwischen den Länderverfassungen und der vorläufigen Bundesverfassung muß daher zu Gunsten der letzteren entschieden werden.
Dieser Standpunkt kann auch für den Grundrechtskomplex unter Umständen bedeutsam werden.
11. Artikel 139 (Aufrechterhaltung der Entnazifizierungsbestimmungen):
Diese Vorschrift erhielt ihre Fassung bereits in der 16. Sitzung des Organisationsausschusses. Der hier normierte Vorbehalt wurde, entgegen dem Vorschlag des Herrenchiemseer Entwurfes, auf bereits erlassene Rechtsvorschriften beschränkt und nicht auch auf erst noch ergehende Rechtsvorschriften erstreckt. Die Erteilung einer derart weitgehenden „Blanko-Vollmacht“ wurde nicht für richtig erachtet.
In der vierten Lesung (57. Sitzung) lehnte der Hauptausschuß einen Antrag des Abg. Dr. Seebohm (DP) ab, dem Artikel die Fassung zu geben:
Die zur Beseitigung des Nationalsozialismus und Militarismus erlassenen Rechtsvorschriften . . .
Der Artikel war insbesondere deshalb erforderlich, weil die in Frage kommenden Bestimmungen vielfach, wie der Abg. Dr. Dehler (FDP) in der 27. Sitzung des Organisationsausschusses besonders hervorhob, in schroffem Widerspruch zu den Grundrechten stehen.
In der 31. Sitzung des Organisationsausschusess stellte der Abg. Dr. Lehr (CDU) die Frage, ob nicht der Artikel überhaupt gestrichen werden könne. Darauf wurde jedoch von dem Abg. Dr. Katz (SPD) entgegnet, das sei unmöglich, da andernfalls unter Umständen schwierige Rechtsfragen sich erhöhen, z. B. weil die Entnazifierungsvorschriften mit gewissen Beamten- und Grundrechten kollidierten.
Der Vorsitzende des Hauptausschusses, der Abg. Dr. Schmid (SPD), warf andererseits in der vierzigsten Sitzung des Hauptausschusses die Frage auf, ob durch den Artikel tatsächlich alles gedeckt werde, was gedeckt werden müßte. So sei in Württemberg-Hohenzollern außer dem Befreiungsgesetz zur Korrektur einiger Mängel, die sich bei der Anwendung dieses Gesetzes ergeben hätten -zu freigebige Entlastung durch die Spruchkammern und ähnliches -, noch ein besonderes Gesetz ergangen, das es der Regierung ermögliche, auch Beamten, die etwa für entlastet erklärt worden seien, trotzdem den Genuß ihrer alten Rechte zu versagen, weil die Spruchkammer-Entscheidung, materiell gesehen, offensichtlich falsch war. Hier handele es sich, streng genommen, nicht um eine „zur Beseitigung…..“, sondern in deren Gefolge ergangene Vorschrift. Demgegenüber machte der Abg. Zinn (SPD) darauf aufmerksam, diese und ähnliche Vorschriften seien schon deshalb nicht aufgehoben, da das Grundgesetz keine wohlerworbenen Rechte kenne.
Daß die Entnazifizierungsvorschriften „unberührt“ bleiben, bedeutet, daß sie trotz an sich gegebener Verfassungswidrigkeit fortgelten. Bei den Rechtsvorschriften handelt es sich teilweise um Bestimmungen landesrechtlichen, teilweise, z. B. in der britischen Zone bei der vom Präsidenten des Zentraljustizamtes unter dem 17.2.47 für die Spruchgerichte erlassenen Verfahrensordnung sowie bei dem sog. Befreiungsgesetz der amerikanischen Zone, um solche zonenrechtlichen Ursprungs. Da sie „fortgelten“ -ausnahmsweise ungeachtet eines an sich bestehenden Widerspruchs zum Grundgesetz -, wäre die Vorschrift des Artikels 125 Ziffer 1, obwohl sie sich zunächst nur auf nicht zum Grundgesetz in Widerspruch stehendes Recht bezieht, auch auf sie zu erstrecken, d. h. die zonenrechtlichen Vorschriften wären nunmehr als -territorial begrenztes -Bundesrecht anzusehen, sofern man dem Entnazifizierungsrecht Strafrechtscharakter beizumessen bzw. das Entnazifizierungsverfahren als gerichtliches Verfahren zu klassifizieren und damit diese Rechtsbereiche in den Gesetzgebungskatalog des Art. 74 einzubeziehen vermag. Das dürfte jedenfalls keinen Schwierigkeiten begegnen, hinsichtlich der erwähnten, in der britischen Zone ergangenen Vorschrift.
Das rechtliche Schicksal bestimmter bisheriger „gesetzgebender“ Körperschaften, Verwaltungseinrichtungen u. ä.
Artikel 122 (Kein Nebeneinanderbestehen mehrerer konkurrierender Gesetzgeber):
Der Organisationsausschuß befaßte sich in seiner 18. Sitzung eingehend mit einer von dem Abg. Dr. Katz (SPD) vorgeschlagenen Bestimmung:
Mit dem Zusammentreten der Volkskammer und der Länderkammer erlischt das Mandat des Wirtschaftsrates und des Länderrates.
Von dem Abg. Dr. Katz (SPD) wurde dazu erläuternd bemerkt, der einzige andere bestehende Gesetzgeber, das Zentraljustizamt für die britische Zone, könne bei der Regelung unbedenklich ausgelassen werden. Durch die Wendung „erlischt“ komme am besten zum Ausdruck der mit der Vorschrift verfolgte Zweck, daß zu keinem Zeitpunkt zwei konkurrierende Gesetzgeber bestehen dürften. Auf einen Hinweis des Abg. Dr. Schwalber (CSU), daß Länder- und Wirtschaftsrat durch eine Proklamation der Besatzungsmächte ins Amt gesetzt seien, erklärte der Abg. Dr. Katz (SPD) es für dringend erforderlich, daß auch deutsche, aufgrund Besatzungsrechts entstandene Institutionen in die Neuordnung einbezogen würden. Die dazu erforderliche Zustimmung der Militärregierungen sei in der Erklärung ihres Einverständnisses mit dem Inhalt des Grundgesetzes zu erblicken. Mit dieser Auffassung erklärte sich der Vorsitzende, der Abg. Dr. Lehr (CDU), einverstanden unter Hervorhebung der Schwierigkeit einer staats- und völkerrechtlich richtigen Beurteilung des Zonenbeirats in Hamburg: „Ich habe ihn im Grunde genommen immer betrachtet als ein Beratungsorgan, sozusagen einen Kronrat der britischen Abteilung der Kontrollkommission“. Durch Erstreckung der vorgeschlagenen Vorschrift auch auf ihn würden alle Schwierigkeiten mit Leichtigkeit aus dem Wege geräumt. Der Ausschuß beschloß: „mit . . . endet die Zuständigkeit der zonalen und bizonalen Körperschaften zur Gesetzgebung“.
In einem Gutachten des Rechnungshofes wurden gegen die vorgeschlagene Lösung Bedenken erhoben. Die von den gesetzgebenden Organen des Bundes zu beschließenden Gesetze würden wirksam erst mit der Ausfertigung und Verkündung durch den Bundespräsidenten, dessen Verkündungsanordnung der Gegenzeichnung bedürfe. Die Durchführung der Wahl des Bundespräsidenten sowie die Bildung der Bundesregierung könnten längere Zeit in Anspruch nehmen und deshalb ein Notstand eintreten, wenn die Zuständigkeit der zonalen und bizonalen Stellen zur Gesetzgebung bereits mit dem Zusammentritt der zuständigen Bundesorgane enden würde. Es empfehle sich, die Zuständigkeit dieser Stellen erst mit der Bildung der Bundesregierung enden zu lassen.
Dem Redaktionsausschuß erschien es (Vorschlag vom 18.11.1948) richtig, um den möglichst besten Anhaltspunkt zu gewinnen, lediglich auf den Zusammentritt des Bundestages abzustellen. Ferner werde zweckmäßig ausdrücklich ausgesprochen, daß die Gesetzgebung von diesem Zeitpunkt an ausschließlich den in diesem Grundgesetz selbst anerkannten Trägern der gesetzgebenden Gewalt obliege; seine Anregung ging deshalb dahin:
1. Vom Tage des Zusammentritts des Bundestages an wird die Gesetzgebung ausschließlich durch die in diesem Grundgesetz anerkannten gesetzgebenden Gewalten ausgeübt.
2. Gesetzgebende und bei der Gesetzgebung beratend mitwirkende Körperschaften, deren Zuständigkeit nach Absatz 1 endet, sind mit diesem Zeitpunkt aufgelöst.
In der 27. Sitzung des Organisationsausschusses wurde nochmals, insbesondere von den Abgeordneten Dr. Dehler (FDP) und Dr. Katz (SPD), zum Ausdruck gebracht, es sei untragbar, wenn nach dem Zusammentritt des Bundestages unter Umständen mehrere Gesetzgeber nebeneinander existieren würden. Demgegenüber müsse als unbedingt kleineres Uebel ein etwaiges Interregnum von einigen Wochen in Kauf genommen werden. Der Ausschuß pflichtete aus diesem Grunde dem Vorschlage des Redaktionsausschusses bei.
Der Hauptausschuß nahm in erster Lesung (20. Sitzung) die Vorschriften ebenfalls, und zwar einstimmig, an, nachdem einem Entwurf des Abg. Dr. Seebohm (DP), es sei doch wohl klar, daß zu den aufgelösten gesetzgebenden Körperschaften nicht die Landtage gehörten, von dem Abg. Dr. von Brentano (CDU) mit dem Hinweis begegnet worden war, diese seien durch das Grundgesetz anerkannt. In der zweiten Lesung des Hauptausschusses (39. Sitzung) erhielt die Bestimmung nach einigen unwesentlichen redaktionellen Verbesserungen ihre endgültige Fassung.
Von dem Abg. Dr. Strauß (CDU) wurde zu einem späteren Zeitpunkt darauf hingewiesen, daß mit der Möglichkeit zu rechnen sei, der Wirtschaftsrat werde vor seiner Auflösung ein Gesetz verabschieden, das von den Militärregierungen genehmigt werde, aber infolge Auflösung des Wirtschaftsrates nicht mehr durch dessen Präsidenten ausgefertigt und verkündet werde. Dr. Strauß (CDU) empfahl deshalb, in einer Ueberleitungsbestimmung festzulegen, daß der Bundespräsident ohne Gegenzeichnung anstelle des Präsidenten des Wirtschaftsrates Gesetze des Wirtschaftsrates mit Wirkung für das Vereinigte Wirtschaftsgebiet ausfertigen und verkünden könne. Gegen diesen Vorschlag wurden von dem Präsidenten Dr. Adenauer rechtliche Bedenken geäußert. Der Abg. Zinn (SPD) war der Ansicht, der Wirtschaftsrat könne es so einrichten, daß Gesetze, auf die es ankomme, noch rechtzeitig ausgefertigt und verkündet würden. Von dem Abg. Dr. Schmid (SPD) wurde betont, der Wirtschaftsrat werde solange leben, bis das Grundgesetz effektiv geworden sei, d. h. bis zum ersten Zusammentritt des Bundestages. Mit diesem Augenblick gebe es kein Organ zur Genehmigung mehr. Da ein Nullum da sei, müsse ein Gesetz erlassen werden. Nach Auffassung des Abg. Dr. Menzel (SPD) sollte eine Uebergangsbestimmung doch erwogen werden. Unter Umständen beschließe der Wirtschaftsrat acht Tage vor seinem Ende ein eiliges Gesetz, bei dem die Genehmigung nicht so schnell erteilt werde. Später könne es dann nicht durchgeführt werden. Von dem Abg. Zinn (SPD) wurde bemerkt, die Genehmigung könne von dem Bipartite Control Board noch am Tage vor dem Zusammentritt des Bundestages erteilt werden. Im Augenblick des Zusammentritts ende seine Funktion. Von diesem Zeitpunkt an könne weder der Wirtschaftsrat Gesetze beschließen noch könnten Gesetze genehmigt werden. Es sei richtiger, in solchen Fällen die ganze Angelegenheit der Erledigung durch den Bundestag vorzubehalten.
Die ausschließliche Statuierung der Gesetzgebungsbefugnis der in diesem Grundgesetz anerkannten gesetzgebenden Gewalten -dazu gehören auf der Bundesebene der Bundestag, der Bundesrat (streng genommen nur, soweit dieser ein Zustimmungsrecht besitzt) und das Volk (sei es im gesamten Bundesgebiet, sei es in einzelnen Gebietsteilen, Artikel 29, Artikel 119), dagegen nicht die Bundesregierung, da sie nicht im Besitze eines formellen Gesetzesbeschlußrechtes ist, auf der Landesebene das jeweilige Landesparlament bzw. Landesvolk; -in Absatz 1 bedeutet nach dem Wortlaut nur das Ende des Gesetzesbeschlußrechts aller anderen Instanzen. Absatz 2 geht dagegen davon aus, daß nach Absatz 1 unter Umständen auch die Zuständigkeit nur beratend an der Gesetzgebung mitwirkender Körperschaften endet. Das bedeutet: soweit das Gesetzesbeschlußrecht einer durch dieses Grundgesetz anerkannten (parlamentarischen) Körperschaft zusteht, ist auch weiterhin die Tätigkeit anderer, „beratend“ mit dieser Körperschaft zusammenwirkender Instanzen zulässig. In allen anderen Fällen dagegen endet auch die Zuständigkeit der letzteren und sind diese als aufgelöst anzusehen. Daraus ergibt sich einerseits: ebensowenig wie z.B. der bayerische Landtag ist etwa der bayerische Senat aufgelöst. Andererseits folgt daraus: aufgelöst nach Absatz 2 ist, wie sich auch aus der Entstehungsgeschichte unzweideutig ergibt, z. B. der Zonenbeirat in Hamburg. Er war nicht etwa eine „der Verwaltung dienende Einrichtung“, sondern wirkte beratend an der Gesetzgebung (wenn auch derjenigen der Militärregierung) mit (Absatz 1). Nach Absatz 2 sind ferner, da ihre Zuständigkeit nach Absatz 1 endigt, aufgelöst: Wirtschafts- und Länderrat des Vereinigten Wirtschaftsgebietes sowie der Länderrat (einschließlich des Parlamentarischen Rates) der amerikanischen Zone. Beendet ist auch gemäß Absatz 1 die Gesetzgebungskompetenz des Zentraljustizamtes; gleichwohl ist es, ausnahmsweise, nicht gemäß Absatz 2 aufgelöst, einmal weil es keine „gesetzgebende Körperschaft“ in diesem Sinne darstellt, und zum zweiten, da es außer Gesetzgebungs- auch Verwaltungsaufgaben zu erfüllen bat. Es fällt, unter Begrenzung auf den zuletzt genannten Aufgabenbereich, unter die Bestimmung des Artikels 130.
Artikel 150 (Unterstellung bisheriger Verwaltungseinrichtungen bzw. -organe u. ä. unter die Bundesregierung):
In der Begründung zum Herrenchiemseer Entwurf war gesagt worden: „Offengelassen wurde die Ueberleitung der bizonalen und trizonalen Einrichtungen, der gemeinsamen Ländereinrichtungen in der amerikanischen und französischen Zone und der Rechtsnachfolge-Verwaltungen in der britischen Zone.“ Dagegen machte der Organisationsausschuß (18. Sitzung) den wie folgt lautenden Vorschlag:
Die Bundesregierung regelt alle Einzelheiten der Abwicklung der zonalen und bizonalen Behörden.
Eine gutachtliche Aeußerung des Rechnungshofes empfahl, stattdessen von „zonalen und bizonalen Verwaltungen“ zu sprechen, im Hinblick darauf, daß z. B. der Wirtschaftsrat keine Behörde, sondern ein Organ oder eine Einrichtung sei, das in den Bestimmungen der Militärregierungen als „Verwaltung“ (!) bezeichnet werde.
Der Redaktionsausschuß hielt es ebenfalls nicht für richtig, nur einen einzelnen, juristisch nicht präzise genug umrissenen Ausdruck wie etwa „zonale und bizonale Behörden“ aber auch „Verwaltung“ zu verwenden und wollte stattdessen eine genauere Umschreibung wählen. Außerdem erachtete er eine besondere Erwähnung der Selbstverwaltungseinrichtungen und eine Regelung der Dienststrafgewalt über die Bediensteten der überführten Behörden usw. für erforderlich. Diesen Anregungen folgend faßte der Hauptausschuß in erster Lesung (20. Sitzung) die Bestimmung wie folgt:
1. Verwaltungsorgane, Behörden und sonstige der öffentlichen Verwaltung oder Rechtspflege dienenden Einrichtungen, die nicht auf Landesrecht oder Staatsverträgen zwischen Ländern beruhen, unterstehen der Bundesregierung oder dem zuständigen Bundesminister. Diese regeln innerhalb ihrer Zuständigkeit mit Zustimmung des Bundesrates die Auflösung, Abwicklung oder Ueberführung.
2. Die Dienststrafgewalt wird von dem zuständigen Bundesminister, im Zweifel von dem Bundesinnenminister ausgeübt.
3. Nicht landesunmittelbare und nicht auf Staatsverträgen zwischen den Ländern beruhende Selbstverwaltungen unterstehen der Aufsicht der zuständigen obersten Bundesbehörde.
Der Organisationsausschuß hatte bereits vorher (27. Sitzung) den Vorschlag des Redaktionsausschusses akzeptiert. Dabei war von dem Abg. Dr. Dehler (FDP) darauf hingewiesen worden, daß mit dem Begriff „der Rechtspflege dienende Einrichtungen“ inbesondere die Kölner Gerichte gemeint seien (d. h. der Oberste Gerichtshof für die britische Zone und das Deutsche Obergericht für die Bizone), deren Entstehung jeweils auf einem Akt der Besatzungsmächte beruht.
Für die zweite Lesung des Hauptausschusses regte der Redaktionsausschuß an, die „Behörden“ nicht gesondert neben den „Verwaltungsorganen“ aufzuführen, bezüglich der Ausübung der Dienststrafgewalt den Passus „im Zweifel vom Bundesinnenminister“ zu streichen und schließlich den Begriff „Selbstverwaltungen“ durch den Begriff „Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts“ zu ersetzen. Der Organisationsausschuß folgte der Anregung (30. Sitzung), nachdem der Abg. Dr. Dehler (FDP) in der Zwischenzeit aufgetretene Mißverständnisse dahin aufgeklärt hatte, daß die bizonalen Einrichtungen zunächst einmal weitergeführt, aber dadurch noch keine Bundesbehörden würden; gleichwohl müßten insoweit die zuständigen Bundesminister die Dienstgewalt ausüben. Neben den „Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts“ auch die „Stiftungen“ besonders zu erwähnen, erschien nicht erforderlich. Der Hauptausschuß schloß sich dem Vorschlag ebenfalls an (39. Sitzung).
In der Vorlage des Redaktionsausschusses vom 25.1.1949 war im Absatz 1 noch eingefügt worden „die Betriebsvereinigung der südwestdeutschen Eisenbahnen und der Verwaltungsrat für das Post- und Fernmeldewesen für das französische Besatzungsgebiet“. Diese Einfügung ist bisher nicht gegenstandslos geworden durch das Mitte August in Frankfurt beschlossene Abkommen über den Zusammenschluß der Eisenbahnen in den drei Westzonen, in dem vereinbart wurde, schrittweise die wichtigsten Verwaltungsaufgaben zusammenzulegen, ganz abgesehen davon, daß die Durchführung des Abkommens zunächst am Widerspruch der Besatzungsmächte gescheitert ist.
Zur Klarstellung, daß die Zuständigkeit etwaiger bereits geschaffener Dienststrafgerichte nicht berührt wird und auch eine Ausübung von Dienststrafbefugnissen durch die unteren Disziplinarvorgesetzten durchaus möglich bleiben soll, schlug der Redaktionsausschuß für den Absatz 2 eine Fassung folgenden Wortlauts vor:
Oberster Disziplinarvorgesetzter der Angehörigen dieser Verwaltungen und Einrichtungen ist der zuständige Bundesminister.
In dieser -abgeänderten -Fassung ging die Bestimmung dann durch alle folgenden Lesungen.
Unter Artikel 130 fällt nicht eine nach Artikel 122 Absatz 2 bereits aufgelöste gesetzgebende Körperschaft wie etwa der Frankfurter Wirtschaftsrat als solcher oder der Frankfurter bzw, der süddeutsche Länderrat usw.. Dagegen fallen unter diese Bestimmung der Oberste Gerichtshof für die britische Zone sowie das Deutsche Obergericht für die Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes. Das letztere, auf Grund der Proklamation Nr. 8 der amerikanischen bzw. der Militärregierungsverordnung 127 der britischen Militärrregierung ins Leben gerufene Gericht bildet bisher ebenso wie seine Generalanwaltschaft einen staatsrechtlich selbständigen Verwaltungskörper, ein selbständiges Staatsorgan, das der Kontrolle des Parlaments nur haushaltsmäßig, der Aufsicht einer Verwaltung, insbesondere einer Justizverwaltung im üblichen deutschen Sinne, bisher im allgemeinen nicht unterlag. Unter Artikel 130 fallen weiter außer den noch bestehenden Rechtsnachfolge-Verwaltungen (Zonenämter) der britischen Zone, einschließlich des Zentraljustizamtes (dem gemäß Artikel 122 keine Gesetzgebungsbefugnisse mehr zustehen), insbesondere die Verwaltungsorgane, „Einrichtungen“ der Bizone: d..h. die für rechtsfähig erklärte „Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes“ als solche nebst dem Verwaltungsrat sowie den in der Proklamation Nr. 7/ Verordnung 126 bezeichneten einigen anderen „Verwaltungsstellen“ wie dem Personalamt, dem Statistischen und dem Rechtsamt.
Zu den von dieser Bestimmung umfaßten Einrichtungen usw. gehören also auch, und zwar in erster Linie, kraft besatzungsrechtlicher Organisationsvorschriften konstituierte Stel!en. Die Durchführung der Ueberführung wird von der Bundesregierung in Form von Verwaltungsverordnungen vorzunehmen sein.
Fragen der Rechts- bzw. Vermögensnachfolge:
Artikel 133 (Eintritt des Bundes in die Rechte und Pflichten der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes):
In der 18. Sitzung des Organisationsausschusses machte der Abg. Dr. Strauß (CDU) darauf aufmerksam, daß die gegenwärtige Frankfurter Institution nach dem Ueberleitungsgesetz vom August 1947 nicht Rechtsnachfolger der damals bestehenden fünf über die englische und amerikanische Zone verstreut gewesenen Verwaltungsämter sei. In ähnlichem Sinne halte er es für falsch, wenn Bundesministerien im juristischen Sinne Rechtsnachfolger der bizonalen Verwaltung würden. Darauf schlug die Abg. Dr. Selbert (SPD) die Aufnahme einer Bestimmung vor, daß die Bundesbehörden oder Bundesstellen nicht Rechtsnachfolger der bizonalen Stellen seien. Gegebenenfalls sei eine allumfassende Regelung dahin am Platze, daß die Haftung für irgendwelche Handlungen bizonaler und zonaler Stellen auf den Bund nicht übergehe. Dagegen hielt es der Abg. Dr. Fecht (CDU) nicht für möglich, in dieser Form ganz allgemein jede Haftung des neuen Staates für Dinge, die unter der bizonalen Verwaltung vorgekommen seien, abzulehnen, das sei der Bevölkerung gegenüber nicht zu verantworten. Noch schärfer äußerte sich der Abg. Dr. Dehler (FDP): „Wir können die Rechtsnachfolge nicht leugnen. Die Bizone ist doch eine Stufe auf dem Wege, den wir gegangen sind und weitergehen“. Der Abg. Dr. Katz (SPD) trat der Ansicht der Abg. Dr. Selbert (SPD) insofern entgegen, als eine -beschränkte -Rechtsnachfolge in Bezug auf die Haftpflicht oder ähnliches nicht geleugnet werden könne: „Schließlich sind doch die Bestimmungen zum Schutz des Bürgers und der Bevölkerung da. Wir wollen auch dcn Staatsgedanken nicht vor den Schutz der Bevölkerung stellen“. Andererseits könne nicht eine minutiöse Ordnung aller Eventualitaten vorgenommen werden, jedoch müsse die Idee festgelegt werden, daß eine Rechtsnachfolge der Behörden als solcher ganz generell nicht bestehe. Diese Auffassung wurde vom Ausschuß geteilt, wobei besonders zum Ausdruck kam, daß damit keine Festlegung für Einzelfragen wie z. B. Haftpflichtfragen verbunden sei. Man gelangte zu der Formulierung:
Die Verwaltungen des Bundes sind nicht Rechtsnachfolger von Verwaltungen bisheriger zonaler oder bizonaler Einrichtungen.
Diese Formulierung fand Widerspruch in einem Gutachten des Rechnungshofs mit der Begründung, eine „Rechtsnachfolge“ unter Verwaltungen oder Behörden sei ohnedies begrifflich nicht möglich; sie könne nur unter selbständigen Rechtspersönlichkeiten stattfinden. Ob zwischen dem Vereinigten Wirtschaftsgebiet auf den Zonen auf der einen Seite sowie dem Bund und der anderen Seite eine Rechtsnachfolge in vermögensrechtlicher Hinsicht überhaupt stattfinden könne, hänge deshalb davon ab, ob Vereinigtes Wirtschaftsgebiet, Zonen und Bund selbständige Rechtspersönlichkeiten (juristische Personen des öffentlichen Rechts) seien oder nicht. Sollte aber z. B. das Vereinigte Wirtschaftsgebiet als eine selbständige Rechtspersönlichkeit anzusehen sein, dann würde dies bei einem Ausschluß der allgemeinen Rechtsnachfolge im Grundgesetz zur Folge haben, daß das kraft Verfassung für die Uebernahme auf den Bund in Betracht kommende Vermögen nicht auf diesen insgesamt übergehen werde, ein wohl kaum beabsichtigtes Ergebnis. Aus diesem Grunde werde von einer ausdrücklichen Regelung dieser Frage am zweckmäßigsten ganz abgesehen.
Es konnte dabei jedoch nicht außer Acht gelassen werden, wie die Rechtspersönlichkeit der bizonalen Organisation durch die Proklamation Nr.7/Verordnung 126 der Militärregierungen gestaltet worden ist. Zwar ist der Plan des ursprünglichen Entwurfes dieser Bestimmung, nach dem die Wirtschaftsverwaltung eine „Körperschaft des öffentlichen Rechts“ sein sollte, auf deutsche Gegenvorstellungen hin nicht verwirklicht worden. Der Grund für diese deutsche Stellungnahme war die Befürchtung, daß die Stellung als Körperschaft des öffentlichen Rechts im Zusammenhang mit der Bezeichnung „Vereinigtes Wirtschaftsgebiet“ zu der Vorstellung einer Gebietskörperschaft führen werde und damit die Gefahr mit sich bringe, daß die ganze Institution von sich aus zum Ansatz für die Bildung eines neuen Staates werde. Es genügte nach deutscher Ansicht, daß die verschiedenen Dienststellen am Privatrechtsverkehr teilnehmen, also klagen und verklagt werden könnten, und daß folglich die „Verwaltung“ „rechtsfähig“ sei. (Höpfner in Monatsschrift für Deutsches Recht 1949 S. 200). Diese Rechtsfähigkeit ist der Verwaltung dann auch ausdrücklich verliehen worden. Ob im übrigen „die Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes“ ein Zweckverband oder eine Verwaltungsunion der Länder ist (so Dr. Strauß in seinen Schriften sowie in der 18. Sitzung des Organisationsausschusses) oder etwa eine Erscheinungsform des Deutschen Reiches (von Mangoldt in M. D. R. 1948, S. 438) oder nur das Ergebnis einer Vereinbarung der Besatzungsmächte (vgl. Ehard, S. J. Z. 1947, S. 586 ff.) oder eine völkerrechtliche Verwaltungsgemeinschaft der Besatzungsmächte mit deutschen Hilfsorganen (so Hoepfner a. a. O., S. 197), muß dahingestellt bleiben.
Für jeden Fall aber hielt der Redaktionsausschuß eine Regelung für erforderlich, allerdings, im Gegensatz zu dem Vorschlag des Organisationsausschusses, in Gestalt der Statuierung einer grundsätzlichen Gesamtrechtsnachfolge, und zwar in folgender Form (Vorschlag vom 18.11.1948):
Der Bund tritt in die Rechte und nach Maßgabe besonderer gesetzlicher Bestimmungen in die Pflichten der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes ein.
Zur Begründung wies der Redaktionsausschuß darauf hin, er halte einen unmittelbaren Uebergang der aus von Verwaltungen des Vereinigten Wirtschaftsgebietes abgeschlossenen Verträge herrührenden Rechte für erforderlich. Für den Uebergang der Pflichten müsse noch erwogen werden, ob die Verweisung auf spätere gesetzliche Bestimmungen, die zunächst eine völlige Unsicherheit schaffe, zweckmäßig und sachlich gerechtfertigt sei, oder ob nicht stattdessen ein vorbehaltloser Uebergang der Pflichten bestimmt werden solle, ggf. unter gleichzeitiger Gewährung eines Kündigungsrechts für langfristige Verträge.
Dem ursprünglichen Vorschlag des Organisationsausschusses wollte der Abg. Dr. Katz (SPD), unter Beibehaltung des damit ausgesprochenen Grundprinzips, in der 27. Sitzung des Organisationsausschusses eine präzisere Fassung durch folgende Formulierung geben:
Der Bund ist nicht Rechtsnachfolger bizonaler und zonaler Stellen.
Für die entgegengesetzte, vom Redaktionsausschuß vertretene Rechtsauffassung setzte sich der Abg. Dr. Dehler (FDP) ein: „Wir halten es nicht für möglich, die Dinge völlig in der Schwebe zu lassen. In Frankfurt und in Hamburg laufen Mietverträge und sonstige Verträge, die ja weiterlaufen müssen. Das sind Werte…..wir halten es für richtiger, die Rechte ohne weiteres einmal zu übernehmen. Daraus entspringen ja keine Haftungen. Gegenüber einem Einwand des Abg. Heiland (SPD), selbstverständlich entspringen daraus Haftungen, verwies Dr. Dehler auf die Erläuterung des Redaktionsausschusses und bemerkte weiter, die Verwaltungen hätten Funktionen stellvertretend für den Bund ausgeübt. Der Bund könne sich nicht ohne weiteres aller dieser Verpflichtungen entschlagen und auf Rechte verzichten, die aus Verträgen dieser Verwaltungen entstanden seien. Der Abg. Dr. Katz (SPD) hielt an seinem Standpunkt fest mit der Begründung: „Der bizonale Apparat war doch nicht ein Staat, sondern war ein bestimmtes Verwaltungsgebiet. Das neue Gebilde wird ein Staat. Der Hauptfall wird durch Artikel 143 b (jetzt Artikel 130) behandelt, wonach die Bundesregierung alle Einzelheiten der Abwicklung regelt. Der vorliegende Artikel soll nur einen generellen Grundsatz aufstellen, der aus grundsätzlichen Erwägungen die Identität des bisherigen Wirtschaftsgebildes der Bizone mit dem neuen Staatsgebilde verneint.“ Der Abg. Dr. Dehler (FDP) trat dem entgegen mit der Bemerkung: „Dann hängen alle Dinge zunächst in der Luft, es ist niemand mehr da, der die Rechte geltend macht.“ Ergänzend schlug er vor, daß für den Streitfall das Bundesverfassungsgericht zuständig sein solle. Bei der Abstimmung wurde mit Stimmengleichheit -sechs zu sechs -sowohl die Fassung des Redaktionsausschusses wie die frühere Fassung des Organisationsausschusses verworfen.
Für die erste Lesung im Hauptausschuß (20. Sitzung) wurde der Vorschlag des Redaktionsausschusses als Antrag von der CDU übernommen, die Fassung des Organisationsausschusses dagegen als Antrag von der SPD. Als Berichterstatter bemerkte der Abg. Dr. Lehr (CDU), da die zonalen bzw. bizonalen Dienststellen „nicht gut als Rechtsvorgänger der kommenden Regierung betrachtet“ werden könnten, seien gewisse ausdrückliche Vorschriften unbedingt erforderlich. Der Abg. Zinn (SPD) -als Vorsitzender des Redaktionsausschusses -wies darauf hin, daß nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen die Vermögensnachfolge nicht ausgeschlossen werden könne. Da der Bund zweifellos die Aktiven innerhalb der Frankfurter Verwaltungen erben wolle, übernehme er, zumindest in diesem Umfange, auch etwaige Verpflichtungen. Deshalb müsse die Rechtsnachfolge festgelegt werden, soweit die Aktiven in Frage kämen; darüber hinaus sollte die Rechtsnachfolge auch hinsichtlich der Verpflichtungen allgemein anerkannt werden. Allerdings müsse hier eine besondere gesetzliche Regelung vorbehalten werden, um z. B. langfristige Verträge lösen zu können. Man könne die Rechtsnachfolge auch nicht aus Gründen verneinen, die mit der gesamten Wirtschaftspolitik der Bizone zusammenhingen, denn dann würde die Bizone Gefahr laufen, Verträge, die z. B. mit dem Ausland abgeschlossen werden müßten, um die Ernährung sicherzustellen, nicht mehr abschließen zu können, weil das Ausland sich auf ein durch die zu erwartende Verneinung der Rechtsnachfolge unsicheres Geschäft nicht einlassen werde. Der Abg. Dr. Schmid (SPD) betonte, in jedem Falle, auch bei Annahme des Vorschlages der SPD, werde die Schaffung eines besonderen „Ueberleitungsgesetzes“ nicht zu vermeiden sein. Nach Ablehnung des SPD-Antrages wurde der Antrag der CDU mit fünfzehn gegen eine Stimme angenommen. Dabei war dem Vorschlag des Redaktionsausschusses ein zweiter Absatz angefügt worden:
Streitigkeiten entscheidet das Bundesverfassungsgericht.
Dieser zweite Absatz wurde vom Hauptausschuß in zweiter Lesung (40. Sitzung) wieder gestrichen, nachdem der Redaktionsausschuß darauf aufmerksam gemacht hatte, er erübrige sich, da nicht anzunehmen sei, daß sich aus der in Absatz 1 getroffenen Regelung Schwierigkeiten ergäben, für die eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts notwendig sei. Der Vorsitzende des Hauptausschusses, Dr. Schmid (SPD), hatte noch darauf hingewiesen, daß damit die besonderen Verhältnisse in der französischen Zone keine Regelung erführen. Dort gebe es keine zonalen Einrichtungen im Rechtssinne, aber eine ganze Reihe von Einrichtungen, die zwar die Länder führten, jedoch, materiell gesehen, für die Zone, weil eben entsprechende überländermäßige Zusammenfassungen noch nicht bestünden.
Während, einem übereinstimmenden Vorschlage des Redaktionsausschusses und Fünfer-Ausschusses folgend, die Fassung gemäß zweiter Lesung vom Hauptausschuß auch in der dritten Lesung (51. Sitzung) aufrecht erhalten wurde, regte der Redaktionsausschuß, auf seine ursprünglichen Erwägungen zurückgreifend, für die vierte Lesung den vorbehaltlosen Eintritt des Bundes auch in die Pflichten der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes an. Diesem Vorschlage wurde vom Hauptausschuß wie auch vom Plenum in beiden Lesungen entsprochen und damit das Prinzip der Universalsukzession statuiert, ohne daß irgendwelche weiteren Diskussionen noch stattgefunden hätten.
Ob dem Bund die Möglichkeit gegeben ist, gleichwohl von gewissen Verpflichtungen doch wieder loszukommen, inbesondere von langfristigen Verträgen durch Ausübung eines Rücktritts- oder Kündigungsrechtes oder in ähnlicher Weise, ist nunmehr ausschließlich an Hand der bestehenden einschlägigen gesetzlichen Vorschriften bzw. nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen zu entscheiden. Nicht ausgeschlossen ist es aber auch, ggf. insoweit eine besondere gesetzliche Regelung zu treffen, falls sich dies als erforderlich erweisen sollte. Im übrigen handelt es sich, wie bereits hervorgehoben, um eine ipso jure eintretende Rechtsnachfolge; vorgängiger Erlaß eines Bundesgesetzes ist nicht erforderlich.
Artikel 134 (Uebergang des Reichsvermögens):
Die Vorschrift ist zurückzuführen auf einen vom Redaktionsausschuß (unter dem 18.11.1948) gemachten Vorschlag:
Das gesamte Reichsvermögen geht auf den Bund über. Soweit es nach seiner Bestimmung Aufgaben dient, die nach diesem Grundgesetz nunmehr von den Ländern zu erfüllen sind, ist es bis zum…..auf die Länder entschädigungslos zu übertragen.
Der Organisationsausschuß setzte, nachdem der Abg. Dr. Dehler (FDP) betont hatte, die Rechtsnachfolge müsse unbedingt geklärt werden, die Beschlußfassung zunächst aus (27. Sitzung); desgleichen der Hauptausschuß in erster Lesung (20. Sitzung). In dem Vorschlag des Redaktionsausschusses vom 18.12.1948 ist bereits eine detailliertere Fassung vorgesehen, in der es u. a. heißt:
Das Vermögen des Reiches ist Bundesvermögen. Soweit es nach seiner ursprünglichen Zweckbestimmung überwiegend für Verwaltungsaufgaben bestimmt war, die nach diesem Grundgesetz nicht Verwaltungsaufgaben des Bundes sind, ist es unentgeltlich auf die nunmehr zuständigen Aufgabenträger und, soweit es nach seiner gegenwärtigen, nicht nur vorübergehenden Benutzung Verwaltungsaufgaben dient, die nach diesem Grundgesetz nunmehr von den Ländern zu erfüllen sind, auf die Länder zu übertragen.
Auf Grund eines von seinem Unterausschuß unter Beteiligung des Ministerialdirektors Dr. Ringelmann (Bayerische Staatskanzlei) ausgearbeiteten Vorschlages kam der Organisationsausschuß (31. Sitzung) zu folgender Formulierung:
1. Bewegliches und unbewegliches Vermögen des Reiches ist Bundesvermögen; die mit diesem Vermögen in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehenden Forderungen, Verbindlichkeiten und Lasten gehen auf den Bund über. Gesetzliche oder vertragliche Heimfallrechte bleiben unberührt.
2. Vermögen, das dem Reich von den Ländern und Gemeinden (Gemeindeverbänden) unentgeltlich zur Verfügung gestellt wurde, verbleibt den Ländern und Gemeinden (Gemeindeverbänden), soweit nicht der Bund es für eigene Verwaltungsaufgaben benötigt.
3. Verwaltungsvermögen des Reiches wird unentgeltlich Vermögen der Länder und Gemeinden (Gemeindeverbände), wenn die Verwaltung nach diesem Grundgesetz landeseigene Verwaltung oder nach Maßgabe der Landesgesetze Verwaltung der Gemeinden (Gemeindeverbände) wird. Der Bund kann auch sonstiges Vermögen den Ländern übertragen. Dies gilt insbesondere für Beteiligungen an wirtschaftl. Unternehmungen, die nicht Aufgaben des Bundes erfüllen.
4. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.
Auf Grund der Ausführungen des Ministerialdirektors Dr. Ringelmann war der Ausschuß gegen den Uebergang schlechthin aller Schuldverbindlichkeiten des Reiches auf den Bund und außerdem wurde ein besonderer Vorbehalt zugunsten der Heimfallrechte für erforderlich gehalten. Zu letzterem Punkte hatte Dr. Ringelmann u. a. hingewiesen auf die Regelung im Reichseigentumsgesetz von 1873, in dem Gesetz über die Verreichlichung der Justiz vom Jahre 1935 sowie in dem Gesetz über finanzielle Maßnahmen aus Anlaß des Uebergangs der Polizei auf das Reich und auf das Abkommen von 1923 über die Liquidation des bayerischen Militär-Reservates. Die Forderungen waren auf eine Anregung des Abg. Schloer (CSU) ausdrücklich mit einbezogen worden. Nachdem der Abg. Kaufmann (CDU) zu Absatz 2 darauf aufmerksam gemacht hatte, daß in vielen Fällen Gemeinden Uebungsplätze, Kasernen usw. zu äußerst geringen Preisen an den Reichsfiskus abgegeben hätten, wurde von dem Abg Dr. Becker (FDP) festgestellt, daß nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen zur „unentgeltlichen“ Ueberlassung auch das sog. „negotium mixtum cum donatione“ zähle. Den Begriff „Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmungen“ erläuterte Dr. Ringelmann dahin, daß hier namentlich gewisse Wehrmachtsbetriebe, Polizeibetriebe u. ä. in Frage komme. Z. B. habe die Polizei von Dachau in Allach eine Porzellan-Manufaktur für den ehemaligen Reichsführer-SS Himmler errichtet. Außerdem sei in Dachau ein eigenes Forschungsinstitut für den Betrieb eines Kräutergartens und einer Gewürzmühle eingerichtet worden; es kämen auch gewisse Fälle aus dem Bereich der VIAG in Betracht, die nicht nur Beteiligungen an ElektroUnternehmungen, sondern auch an Kalistickstoffwerken, an Aluminiumwerken, an Maschinenfabriken usw. gehabt habe.
In der zweiten Lesung des Hauptausschusses (40. Sitzung) setzte sich der Abg. Dr. Hoepker-Aschoff (FDP) dafür ein, die Worte „bewegliches und unbewegliches“ zu streichen und einfach zu sagen „Vermögen des Reiches wird Bundesvermögen“. Fallen müsse weiter das Wort „Forderungen“ -diese gehörten zum Vermögen -sowie der auf die Heimfallrechte bezügliche Satz, da letztere zu den Verbindlichkeiten und Lasten gehörten. Die Absätze 2 und 3 seien umzustellen, da der Absatz 2 eine Ausnahmeregelung enthalte. lm Absatz 3 brauchte die Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmungen nicht besonders hervorgehoben zu werden, da der Bund ohne weiteres unwichtige Dinge an die Länder abstoßen werde: „Mit einiger Vernunft kann man ja in einer künftigen Bundesregierung auch wohl rechnen“! Dann müsse in einem besonderen Absatz gesagt werden, daß Entsprechendes für das preußische Staatsvermögen gelte. Das bedeute, daß das Verwaltungsvermögen des preußischen Staates im wesentlichen unentgetlich auf die Nachfolgestaaten übergehe, daß dagegen über das nutzbare Vermögen von Fall zu Fall vom Bund eine Entscheidung getroffen werde. Dabei könnten z. B. ohne weiteres Kunstschätze den Ländern unentgeltlich übertragen werden. So sei nichts dagegen einzuwenden, wenn etwa das Land Hessen Wilhelmshöhe und Wilhelmstal und die staatlichen Theater in Wiesbaden und Kassel oder Bayern die Schack-Galerie bekomme. Andere Vermögensobjekte, wie z. B. Domänen und Forsten sollten zwar auch die Nachfolgestaaten erhalten, jedoch sei zu prüfen, ob entgeltlich oder unentgeltlich. Ferner gebe es wirtschaftliche Unternehmungen des preußischen Staates, wie z. B. die Preußische Elektra, die grundsätzlich im Besitz des Bundes bleiben sollten. Die Hinweise des Abg. Dr. Hoepker-Aschoff (FDP) wurden vom Hauptausschuß akzeptiert und die Vorschrift erhielt nunmehr folgende Fassung:
1. Vermögen des Reiches wird Bundesvermögen; die mit diesem Vermögen in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehenden Verbindlichkeiten und Lasten gehen auf den Bund über.
2. Verwaltungsvermögen des Reiches wird unentgeltlich Vermögen der Länder und Gemeinden (Gemeindeverbände), wenn die Verwaltung nach diesem Grundgesetz landeseigene Verwaltung oder nach Maßgabe der Landesgesetze Verwaltung der Gemeinden (Gemeindeverbände) wird. Der Bund kann auch sonstiges Vermögen den Ländern übertragen.
3. Vermögen, das dem Reich von den Ländern und Gemeinden (Gemeindeverbänden) unentgeltlich zur Verfügung gestellt wurde, wird wiederum Vermögen der Länder und Gemeinden (Gemeindeverbände), soweit es nicht der Bund für eigene Verwaltungsaufgaben benötigt.
4. Das Gleiche gilt entsprechend für das preußische Staatsvermögen.
5. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.
Demgegenüber schlug der Redaktionsausschuß (25.1.1949) vor, dem Absatz 1 die lapidare Fassung zu geben:
Das Vermögen des Reiches ist Bundesvermögen.
Ferner sei es mißverständlich, wenn in Abs. 2 der Fassung des Hauptausschusses schlechthin vom „Verwaltungsvermögen“ des Reiches gesprochen werde. Im einzelnen könne zweifelhaft sein, was als „Verwaltungsvermögen des Reiches“ anzusehen sei: „Soll als Verwaltungsvermögen des Reiches das seiner ursprünglichen Zweckbestimmung nach Verwaltungszwecken dienende Reichsvermögen Verwaltungsvermögen sein, auch wenn es jetzt nicht mehr Verwaltungszwecken dient? Soll dagegen Vermögen des Reiches, das zwar nicht seiner ursprünglichen Zweckbestimmung, aber nach seiner gegenwärtigen Sachbenutzung Verwaltungsvermögen ist, als Verwaltungsvermögen des Reiches gelten? Die Fassung des Redaktionsausschusses (vom 16.12.1948) sucht diesen Zweifel, soweit möglich, zu beheben. Ein Justizgebäude gehe nach der Fassung des Redaktionsausschusses auf die Landesjustizverwaltung über, auch wenn es jetzt ganz anderen Zwecken diene. Umgekehrt werde eine Kaserne, die jetzt für die Justizverwaltung umgebaut worden sei, ebenfalls auf die Landesjustizverwaltung übergehen. Der das preußische Staatsvermögen betreffende Absatz 4 sei in jedem Fall zu streichen. Andernfalls würden die Nachfolgeländer des ehemaligen Landes Preußen von vornherein vermögenslos werden und völlig von der kommenden bundesgesetzlichen Regelung abhängig sein. Es sei nicht einzusehen, warum z. B. das Land Rheinland-Pfalz das ehemalige Vermögen des Landes Bayern in der Pfalz erwerben solle, während das Vermögen des ehemaligen Landes Preußen im Lande Rheinland-Pfalz Bundesvermögen werde. Das Gleiche gelte für Hessen. Schließlich müsse in einem weiteren Absatz die Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts begründet werden.
Der Fünfer-Ausschuß trat den Vorschlägen des Redaktionsausschusses im wesentlichen bei, schlug indes eine materielle Neuerung dahin vor, daß das die nähere Regelung enthaltende Bundesgesetz der Zustimmung des Bundesrates bedürfe.
In der 51. Sitzung des Hauptausschusses wurde von dem Abg. Schloer (CSU) die Frage gestellt, ob der Wegfall der den Uebergang der Verbindlichkeiten und Lasten betreffenden Vorschrift in Absatz 1 eine materielle Aenderung bedeute. Darauf wurde von dem Vorsitzenden des Hauptausschusses, dem Abg. Dr. Schmid (SPD), entgegnet: „Wenn Vermögen übergeht, geht es mit allen Aktiven und Passiven über…..Die Sache ist klar: Es gilt das Recht der Universalsukzession. Die Juristen wissen, was das heißt; es ist gar nichts Geheimnisvolles, es bedeutet, daß alle Forderungen und alle Schulden übergehen…..“. Die Vorschrift hatte nach dieser Lesung folgende Form:
1. Das Vermögen des Reiches ist Bundesvermögen.
2. Soweit es nach seiner ursprünglichen Zweckbestimmung überwiegend für Verwaltungsaufgaben bestimmt war, die nach diesem Grundgesetz nicht Verwaltungsaufgaben des Bundes sind, ist es unentgeltlich auf die nunmehr zuständigen Aufgabenträger und, soweit es nach seiner gegenwärtigen, nicht nur vorübergehenden Benutzung Verwaltungsaufgaben dient, die nach diesem Grundgesetz nunmehr von den Ländern zu erfüllen sind, auf die Länder zu übertragen. Die Artikel 118 und 118 a (Reichswasserstraßen bzw. Reichsautobahnen und Reichsstraßen) bleiben unberührt.
3. Vermögen, das dem Reich von den Ländern und Gemeinden (Gemeindeverbänden) unentgeltlich zur Verfügung gestellt wurde, wird wiederum Vermögen der Länder und Gemeinden (Gemeindeverbände), soweit es nicht der Bund für eigene Verwaltungsaufgaben benötigt.
4. Ueber Streitigkeiten entscheidet das Bundesverfassungsgericht.
5. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf.
Im Hinblick auf das Militärregierungsgesetz Nr. 19, das in weitem Umfange einen Vermögensübergang auf die Länder vorsieht, war der Artikel Gegenstand eingehender Beratungen im Redaktionsausschuß unter Beiziehung insbesondere des Abg. Dr. Hoepker-Aschoff (FDP). Der Artikel erhielt seine endgültige Fassung in der vierten Lesung des Hauptausschusses (57. Sitzung) auf Grund eines Antrages des Abg. Zinn (SPD), Dr. von Mangoldt (CDU) und Dr. Dehler (FDP).
Hervorzuheben ist: Den in Artikel 134 statuierten Normen kommt eine sofortige, aktuelle Rechtswirksamkeit nicht zu. Sie bedürfen erst der Aktualisierung durch das in Absatz 4 vorgesehene Bundesgesetz. Es handelt sich um programmatische Rechtsgrundsätze, die Direktiven (Richtlinien) für den künftigen Bundesgesetzgeber darstellen. Dagegen wollte der Redaktionsausschuß mit seiner Fassung „…..ist Bundesvermögen“ den sofortigen, de jure-Uebergang festlegen, als logische Konsequenz des bereits ausdrückich fixierten Identitätsgedankens. Nunmehr aber bleiben alle Rechtsfragen zunächst in der Schwebe, und erst der Bundesgesetzgeber hat zu entscheiden, in welchen Fällen tatsächlich ein unmittelbarer Uebergang auf den Bund stattfindet bzw. in welchen besonderen Fällen, entgegen der in Absatz 1 aufgestellten Regel, Reichsvermögen statt auf den Bund unmittelbar auf andere Körperschaften übergeht. In der Hauptsache -jedoch nicht ausschließlich -wird es sich bei diesen Fällen um die Rückgängigmachung früherer „unentgeltlicher“ Ueberlassungen im Sinne des Absatz 3 handeln. Der Gesetzgeber hat ferner zu bestimmen, wann und wie nach Abs. 2 Satz 2 in Fällen, wo zunächst ein Uebergang auf den Bund stattfindet, später eine (Weiter-)Uebertragung erfolgen soll. Geregelt werden muß die Frage der Entgeltlichkeit bzw. Unentgeltlichkeit solcher Uebertragungen. Eine Regelung muß auch erfolgen für die unter Satz 1 des Absatzes 2 fallenden Fälle, in denen ebenfalls zunächst ein Uebergang auf den Bund und erst anschließend eine -in diesem Fall unentgeltliche -Weiterübertragung vorgesehen ist.
Für die Entscheidung von Streitfällen ist das Bundesverfassungsgericht zuständig, wenn die Voraussetzungen des Artikels 93 Absatz 1 Ziffer 4) („öffentlichrechtliche Streitigkeiten“) gegeben sind.
Artikel 135 (Vermögensübergang bei Aenderung der Landeszugehörigheit eines Gebietes bzw. im Falle nicht mehr bestehender Länder usw.):
Ursprung dieser Bestimmung ist ein Vorschlag des Allgemeinen Redaktionsausschusses (vom 18.12.1948). der lautete:
1. Hat sich nach dem 8. Mai 1945 die Landeszugehörigkeit eines Gebietes geändert, so steht in diesem Gebiet das Vermögen des Landes, dem das Gebiet angehört hat, dem Land zu, dem es jetzt angehört.
2. Das Vermögen nicht mehr bestehender Länder und nicht mehr bestehender anderer Körperschaften des öffentlichen Rechts geht, soweit es nach seiner ursprünglichen Zweckbestimmung überwiegend für Verwaltungsaufgaben bestimmt war, oder nach seiner gegenwärtigen nicht nur vorübergehenden Benutzung überwiegend Verwaltungsaufgaben dient, auf das Land oder die Körperschaften des öffentlichen Rechts über, die nunmehr diese Aufgaben erfüllt.
3. Grundvermögen nicht mehr bestehender Länder geht einschließlich des Zubehörs, soweit es nicht bereits zu Vermögen im Sinne des Absatz 1 gehört, auf das Land über, in dessen Gebiet es belegen ist.
4. Im übrigen wird die Rechtsnachfolge und die Auseinandersetzung über das sonstige Vermögen nicht mehr bestehender Länder oder nicht mehr bestehender Körperschaften des öffendichen Rechts, soweit sie nicht bis zum 1.Januar 1952 durch Vereinbarung zwischen den beteiligten Ländern oder Körperschaften des öffentlichen Rechts erfolgt, durch Bundesgesetz geregelt.
Der Organisationsausschuß fügte mit Rücksicht darauf, daß die Neugliederung der Länder generell in Artikel 29 geregelt ist, in Absatz 1 die Worte „bis zum Inkrafttreten dieses Grundgesetzes“ ein. Ministerialdirektor Dr. Ringelmann warf (31. Sitzung) dabei die Frage auf, wie es sich bei Gebietsveränderungen bestehender Länder mit dem Eigentum von Körperschaften des öffentlichen Rechts verhalte. In Bayern bestehe beispielsweise die Bayerische Staatsbank als Körperschaft des öffentlichen Rechts, die Niederlassungen in Rheinland-Pfalz habe. Es müsse angenommen werden, daß darin keine Aenderung eintrete, daß also nach wie vor die Anstalten, die die Bayerische Staatsbank in der Pfalz habe, vermögensrechtlich der Bayerischen Staatsbank in München weiter gehörten. Der Ausschuß war der Ansicht, daß diese Frage im Grundgesetz nicht geregelt werden könne. Der Vorsitzende, der Abg. Dr. Lehr (CDU), wies darauf hin, daß ggf. Staatsverträge geschlossen werden oder zivilrechtliche Auseinandersetzungen stattfinden müßten, so sei es in Nordrhein-Westalen mit Vermögen öffentlich-rechtlicher Körperschaften gewesen, das in der früheren südlichen Rheinprovinz gelegen sei und nun zu Rheinland-Pfalz gehöre.
In der zweiten Lesung des Hauptausschusses (40. Sitzung) betonte der Abg. Zinn (SPD), daß der Fall des Abs. 2 beispielsweise für den früheren Volksstaat Hessen gegeben sei, von dem ein Teil heute zum Lande Hessen, ein anderer zum Lande Rheinland-Pfalz gehöre. Auf eine Frage des Abg. Dr. Seebohm (DP) zu Absatz 3, ob damit nicht in gewisse Abreden bei der Bildung des Landes Niedersachsen bezüglich des Eigentums gewisser Stiftungen in den früheren Ländern Braunschweig und Oldenburg, die als Grundlage kultureller und sozialer Einrichtungen dienten, eingegriffen würde, wurde von dem Vorsitzenden des Hauptausschusses, dem Abg. Dr. Schmid (SPD), betont, es handele sich nicht um Grundvermögen von Ländern, wenn es Stiftungen gehöre. Mit Rücksicht auf die im vorhergehenden Artikel bezüglich des preußischen Vermögens getroffene Regelung wurde in diesen Artikel ein besonderer Vorbehalt hinsichtlich des früheren preußischen Vermögens aufgenommen.
Vom Redaktionsausschuß wurde vorgeschlagen (unter dem 26.1.1949), in Absatz 2 und 4 neben den Körperschaften auch die Anstalten des öffentlichen Rechts zu erwähnen. Von seinem grundsätzlichen Standpunkt aus, daß das Vermögen des ehemaligen Lartdes Preußen grundsätzlich nicht Bundesvermögen werden und deshalb nicht in den vorangegangenen Artikel einbezogen werden dürfe, regte der Redaktionsausschuß an, insoweit die Bezuguahme auf den vorhergehenden Artikel zu streichen, jedoch in einem weiteren Absatz zu bestimmen:
Beteiligungen des ehemaligen Landes Preußen an Unternehmen des privaten Rechts gehen nach Maßgabe eines Bundesgesetzes auf den Bund über.
Weiter sei ein besonderer Absatz folgenden Wortlauts aufzunehmen:
Soweit über Vermögen, das einem Lande oder einer Körperschaft oder Anstalt des öffentlichen Rechts nach Absatz 1 bis 3 zufallen würde, von dem danach Berechtigten durch ein Landesgesetz auf Grund eines Landesgesetzes oder in anderer Weise bei Inkrafttreten des Grundgesetzes verfügt worden war, gilt der Vermögensübergang als vor der Verfügung erfolgt.
Schließlich müßten Streitigkeiten der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts unterstellt werden. Der Fünfer-Ausschuß erklärte sich mit den Anregungen des Redaktionsausschusses einverstanden, wollte jedoch festgelegt wissen, daß das in Absatz 4 vorgesehene, die Rechtsnachfolge und Auseinandersetzung regelnde Bundesgesetz der Zustimmung des Bundesrates bedürfe. Außerdem wollte er den Absatz 5 wie folgt gefaßt wissen:
Beteiligungen des ehemaligen Landes Preußen an Unternehmen des privaten Rechts gehen, vorbehaltlich anderweitiger Regelung, auf den Bund über. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.
In der dritten Lesung des Hauptausschusses (51. Sitzung) wies der Abg. Dr. Seebohm (DP) darauf hin, durch die Vorschrift des Absatz 1 werde in Rechtsverhältnisse eingegriffen, die sich aus einer vor Inkrafttreten des Grundgesetzes erfolgten Verschmelzung früherer Länder ergeben hätten. So seien die Vernögensverhältnisse der Länder Braunschweig, OIdenburg und Schaumburg-Lippe -bei deren kraft Anordnung der Besatzungsmacht verfügten Zusammenschluß mit der früheren Provinz Hannover zum Lande Niedersachsen -nicht abschließend geregelt worden. Durch die vorgeschlagene Regelung werde diesen ehem. Ländern ihr Vermögen entzogen, ohne daß sie entsprechend früheren Zusagen und Anweisungen in der Lage seien, die aus diesem Vermögen in Zukunft zu erfüllenden kulturellen, sozialen und sonstigen Aufgaben weiter zu leisten. Um klarzustellen, daß dieses Vermögen der früher selbständigen Länder von dem neuen Land nur für solche Zwecke verwendet werden dürfe, für die es ursprünglich angesammelt oder bestimmt worden sei, beantragte er für den Absatz 1 vor den Worten „. . . dem Lande zu . .“ eine Einfügung folgenden Wortlauts: „unter Wahrung seiner ursprünglichen gebietlichen Zweckbestimmung“.
Gegen den Vorschlag des Abg. Dr. Seebohm (DP) wurden von dem Abg. Zinn (SPD) erhebliche Bedenken erhoben: „Er würde erstens Anlaß zu unendlichen Streitigkeiten sein; zweitens würde dadurch de jure etwas fixiert werden, was nicht auf die Dauer fixiert werden kann; drittens ist zu befürchten, daß jetzt wieder Sonderwünsche auftauchen, und daß plötzlich in irgendeinem Gebietsteil, in dem seither keine Sonderregelung getroffen war, sie jetzt verlangt und gefordert werde, daß irgenwelches ursprüngliche Sondervermögen eines Gebietsteiles nunmehr nur Sonderzwecken dieses Gebietes dienen soll.“ Um die Einhaltung gewisser, beim Zusammenschluß früher selbständiger Gebiete gemachter Zusagen zu gewährleisten, solle man den Bundesgesetzgeber zum Schiedsrichter bestimmen und eine entsprechende Regelung durch Bundesgesetz vorsehen. Andererseits könne es sich auch als richtig erweisen, z. B. den über ein ganzes Land oder über verschiedene Länder verstreuten Bestand des Kaiser-Friedrich-Museums zusammenzulassen und nicht das eine Kunstwerk diesem Land und das andere jenem Land zu überlassen. Aus diesem Grunde schlug er den Zusatz vor:
Sofern ein überwiegendes Interesse des Bundes oder das besondere Interesse eines Gebietes es erfordert, kann durch Bundesgesetz eine von Absatz 1 bis 3 abweichende Regelung getroffen werden.
Der Antrag des Abg. Dr. Seebohm (DP) wurde mit elf gegen zehn Stimmen abgelehnt, derjenige des Abg. Zinn (SPD) mit zwölf gegen sechs Stimmen angenommen. Im übrigen fand der Artikel Annahme entsprechend den Vorschlägen des Redaktions- bzw. Fünfer- Ausschusses.
Der gleiche Antrag wurde von dem Abg. Dr. Seebohm (DP) in der vierten Lesung des Hauptausschusses (57. Sitzung) gestellt, aber wiederum, und zwar mit elf gegen sieben Stimmen abgelehnt; desgleichen ein weiterer Abänderungsantrag desselben Abgeordneten, und zwar mit elf gegen acht Stimmen, demzufolge ein neuer Absatz folgenden Wortlauts eingefügt werden sollte:
Zum Vermögen nicht mehr bestehender Länder im Sinne der Absätze 1 bis 4 gehört nicht das Vermögen rechtlich selbständiger KörperschaIten und Stiftungen und anderer Vermögensmassen des öffentlichen Rechts, auch wenn es aus Zuwendungen eines nicht mehr bestehenden Landes stammt. Der Weiterbestand dieser Einrichtungen wird gewährleistet.
Seine endgültige Fassung erhielt der Artikel in der gleichen Sitzung auf Grund eines Antrages der Abgeordneten Zinn (SPD), Dr. von Mangoldt (CDU), Dr. Dehler (FDP) und Dr. Hoepker-Aschoff (FDP), der in der zu dem vorangegangenen Artikel erwähnten Besprechung ebenfalls formuliert worden war.
Der Abg. Dr. Seebohm (DP) stellte seine Anträge auch in der zweiten Lesung des Plenums nochmals; sie verflelen indes auch hier der Ablehnung.
Der Rechtsübergang erfolgt in den Fällen der Absätze 1 bis 3 ipso jure. Allerdings kann ein Bundesgesetz nach Absatz 4 für bestimmte Fälle u. a. (und zwar im Wege der Fiktion) diesen Eigentumsübergang als nicht erfolgt bezeichnen und stattdessen mit rückwirkender Kraft vom Tage des Inkrafttretens des Grundgesetzes an den unmittelbaren Uebergang auf andere Rechtsträger normieren. Eine Fiktion enthält übrigens auch der Absatz 7, nach dem im Interesse der Rechtssicherheit in Fällen der Absätze 1 bis 3 für zurückliegende Verfügungen der Vermögensübergang als bereits vor Inkrafttreten des Grundgesetzes erfolgt anzusehen ist.
Die Regelung des Absatz 6 bezüglich der Beteiligungen des Landes Preußen an Unternehmen des privaten Rechts ist dagegen -insoweit entsprechend der Regelung in Artikel 134 -nicht unmittelbar geltendes Recht. Sie wird rechtlich effektiv erst mit dem Bundesgesetz. Ein Rechtsträger ist hier, nach der Auflösung des Landes Preußen durch Kontrollratsbestimmung, zunächst nicht vorhanden. Da das Gesetz auch „Abweichendes“ bestimmen kann, kann es auch -hier ist eine Fiktion wie im Falle des Absatz 4 nicht erforderlich -anordnen, daß der Uebergang unmittelbar auf andere Rechtsträger stattfindet.
Besondere Gestaltung der rechtichen Position früherer bzw. jetziger Angehöriger des öffentlichen Dienstes:
Artikel 131 (Die Rechtsverhältnisse von Personen, die nach dem 8. Mai 1945 aus dem öffentlichen Dienst „ausgeschieden“ sind):
Geboren wurde diese Bestimmung aus einem Vorschlag des Redaktionsausschusses vom 16.12.1948, der besagte:
Wer sich am 8. Mai 1945 im öffentlichen Dienst in einem Beamten- oder Arbeitsverhältnis befunden hat, kann daraus kein Recht auf Wiedereinstellung herleiten. Die vermögensrechtlichen Ansprüche aus solchen Dienst- und Arbeitsverhältnissen, die am 8. Mai 1945 bestanden haben oder vorher beendet waren, sind durch Bundesgesetz zu regeln.
Der Vorschlag des Redaktionsausschusses begegnete in der Oeffentlichkeit und insbesondere seitens der Berufsorganisationen der Beamten heftiger Kritik. So hieß es in einer Stellunguahme der Gewerkschaft Deutscher Beamtenbund, Landesverband Nordrhein-Westfalen, u. a.: „Die Aberkennung des Rechts auf „Wiedereinstellung“ -letzteres überhaupt ein beamtenrechtlich unmöglicher Ausdruck -würde praktisch dem Grundsatz zum Siege verhelfen, daß den Letzten die Hunde beißen. Dies dürfte gerade für ein Grundgesetz, das das Fundament eines neu auszubauenden Rechtsstaates sein soll, eine unmögliche Forderung sein. Wer aus irgendwelchen von ihm nicht verschuldeten Gründen also noch nicht im Dienst ist, soll diesen Anspruch nicht mehr haben. Damit sind in erster Linie die sogn. verdrängten Beamten betroffen. Anstatt die Kluft zu schließen, wird sie wieder aufgerissen und damit die Beamtenschaft in zwei neue Klassen geteilt. Wir erwarten von beamtenrechtlichen Bestimmungen auch eine konstruktive Beamtenpolitik. Satz 1 ist aber inhaltlich keine positive, sondern eine negative Bestimmung…. Satz 2 läßt für die vermögensrechtlichen Ansprüche in einem zukünftigen Bundesgesetz einen allzuweiten Spielraum offen. Völlig ungeklärt bleibt es, ob diese Beamten dann etwa ein volles Warte- oder Ruhegeld erhalten oder ob solche Beträge gekürzt werden oder man ihnen vielleicht nur eine einmalige Entschädigung bezahlt. Es bestände sogar die Möglichkeit, Entschädigungen in einer Höhe zu zahlen, die sich in ihrem Umfang nicht wesentlich von einer Wohlfahrtsrente unterscheiden würde….“
Der Organisationsausschuß befaßte sich mit der Anregung des Redaktionsausschusses in seiner 30. Sitzung. Während der Abg. Dr. Katz (SPD) den Vorschlag vor allem im Hinblick auf die Belastung der Länder durch die Flüchtlingsbeamten als „gut“ bezeichnete, sah z. B. der Abg. Dr. Mücke (SPD) darin ein „Abgehen von der Basis des Rechts“ und wies darauf hin, da nach dem Befreiungsgesetz der amerikanischen Zone ein politisch be!asteter Beamter kein Recht auf Wiedereinstellung habe, würde praktisch der politisch unbelastete Flüchtlingsbeamte dem politisch belasteten einheimischen Beamten gleichgestellt sein. Der Abg. Dr. Süsterhenn (CDU) machte darauf aufmerksam, daß von der Bestimmung jedenfalls alle -nicht etwa nur die verdrängten -Beamten erfaßt werden müßten, sofern sie ihre Tätigkeit nach dem 8. Mai 1945 noch nicht wieder aufgenommen hätten. Sinn und Zweck der vom Redaktionsausschuß vorgeschlagenen Bestimmung wurde von dem Abg. Dr. Dehler (FDP) mit folgenden Worten erläutert: „Es gab Urteile von Gerichten, die z. B. Kommunen verurteilt haben, den aus irgendeinem politischen Grunde entlassenen Stadtkämmerer einer Stadt, dessen Stelle inzwischen bereits besetzt wurde, wieder als Stadtkämmerer einzusetzen. Eine solche Entwicklung der Rechtsprechung muß abgebremst werden. Deshalb diese weitgehende Bestimmung: Niemand, der am 8. Mai 1945 Beamter und am Ende Beamter Hitlers war, hat einen Anspruch auf das Amt, aber seine vermögensrechtlichen Ansprüche sollen auf diesem Wege irgendwie geregelt werden; das ist der Sinn der Vorschrift.“
Ein vom Organisationsausschuß eingesetzter Unterausschuß, dem als Sachverständiger der Ministerialdirektor Dr. Ringelmann von der Bayerischen Staatsregierung angehörte, kam zu folgender Formulierung: „Die Rechtsverhältnisse von Personen einschließlich der Vertriebenen, die am 8. Mai 1945 im öffentlichen Dienste standen, aus anderen als beamtenrechtlichen Gründen ausgeschieden sind und bisher nicht ihrer früheren Stellung entsprechend verwendet werden, sind durch Bundesgesetz zu regeln. Entsprechendes gilt für Personen einschließlich der Vertriebenen, die am 8. Mai 1945 versorgungsberechtigt waren und aus anderen als beamtenrechtlichen Gründen keine oder keine entsprechende Versorgung mehr erhalten.“ Die Vorlage des Unterausschusses machte sich der Organisationsausschuß in seiner 31. Sitzung zu eigen, nachdem Dr. Ringelmann insbesondere den Begriff „ausscheiden aus anderen als beamtenrechtlichen Gründen“ erläutert und dargetan hatte, unter die Bestimmung falle also z. B. nicht ein Beamter, der seine Entlassung genommen habe, oder der in einem DiszIplinarverfahren aus dem Dienst entfernt worden sei.
In der zweiten Lesung des Hauptausschusses (40. Sitzung) führte Dr. Ringelmann u. a. aus: „Es fallen unter diese Bestimmung in erster Linie Beamte, die infolge Untergangs ihrer Dienststelle im früheren Reichsgebiet ihren Dienstherrn verloren haben. Es fallen weiterhin verdrängte Beamte, also heimatvertriebene Beamte darunter. Es fallen ferner Beamte darunter, die durch Maßnahmen der Besatzungsmacht ihr Amt verloren haben, inbesondere soweit sie parteipolitisch belastet waren, inzwischen denazifiziert wurden und nicht zu der Gruppe der Belasteten oder der Hauptschuldigen gehören, die kraft Gesetzes ihr Amt verloren haben. Es fallen ferner Beamte darunter, die aus der Kriegsgefangenschaft zurückkommen, ihre Stelle besetzt finden, oder für die kein Dienstherr mehr vorhanden ist“. Der Abg. Zinn (SPD), der am Zustandekommen des Vorschlages des Redaktionsausschusses maßgeblich beteiligt war, betonte die besondere Notwendigkeit einer Bestimmung, die eindeutig festlege, daß ein Anspruch auf Wiedereinstellung nicht gegeben sei. Die Formulierung des Organisationsausschusses stelle keinen unmittelbaren Eingriff in das seither geltende Recht dar, sondern lediglich eine Anweisung an den Gesetzgeber. Zu bedenken sei, daß zum öffentlichen Dienst auch die Wehrmacht, sogar die Waffen-SS zu rechnen sei. Es müsse dem vorgebeugt werden, daß durch Urteile der Verwaltungsgerichte, wie in der britischen Zone bereits geschehen, auf die Klage eines nicht mehr tätigen, ausgeschiedenen Beamten festgestellt würde, daß das alte Beamtenverhältnis auf Grund des früheren Rechts noch fortbestehe, und daß der Beamte einen Anspruch auf Wiedereinstellung habe. Außerdem dürfe die Bestimmung nicht unter völliger Uebergehung der Angestellten ausschließlich auf die Beamten abgestellt werden.
Den von dem Abg. Zinn (SPD) geäußerten Bedenken wurde Rechnung getragen, indem Dr. Ringelmann vorschlug, nicht nur ein aus „beamtenrechtlichen“, sondern auch ein aus „tarifrechtlichen“ Gründen erfolgtes Ausscheiden von der in diesem Artikel beabsichtigten Regelung auszunehmen. Der Abg. Dr. Hoepker-Aschoff (FDP) wollte die Befürchtung, daß auf Grund „der heute völlig ungeklärten Verhältnisse Wiedereinstellungsansprüche geltend gemacht und bei den Gerichten durchgesetzt werden könnten“, ausräumen durch Stipulierung einer Vorschrift dahingehend, daß bis zum Erlaß des Bundesgesetzes Rechtsansprüche nicht geltend gemacht werden könnten. Dieser Vorschlag fand die Zustimmung Dr. Ringelmanns -„Einführung einer Sperre für die Zeit bis zum Erlaß des Bundesgesetzes“ -und diejenige des Abg. Zinn (SPD), der allerdings zwei Einschränkungen für erforderlich hielt: „Einmal muß im Interesse der Beamten bis dahin das in Kraft bleiben, was landesgesetzlich geregelt ist. Soweit Länder bisher übergangsweise eine Regelung getroffen haben, muß sie aufrecht erhalten werden. Zweitens muß verhindert werden, daß jetzt für die Zwischenzeit etwa Ansprüche gegen den Staat oder die Gemeinden auf Grund des Angestelltenversicherungsgesetzes geltend gemacht werden“. Nachdem auf Anregung des Abg. Dr. Lehr (CDU) die Ergänzung „vorbehaltlich anderweitiger landesrechtlicher Regelung“ eingefügt worden war, erhielt der Artikel folgenden Schlußsatz:
Bis zum Inkrafttreten des Bundesgesetzes können vorbehaltlich anderweitiger landesrechtlicher Regelung Rechtsansprüche nicht geltend gemacht werden.
Vorher hatte der Abg. Dr. Mücke (SPD) zum Ausdruck gebracht, eine Sperre sei nur für politisch belastete Beamte am Platze. In ähnlichem Sinne hatte sich der Abg. Dr. Seebohm (DP) geäußert und erklärt: „Ich würde Wert darauf legen, daß zu Protokoll genommen wird, daß in dem Fall der Vertriebenen, die nicht politisch belastet sind, Ausnahmen möglich sind. Das wird ja durch die Landesgesetzgebung geschehen können…. Aber es ist gut, wenn das bei den Motiven in Erscheinung tritt“. Der Artikel fand dann mit zwanzig Stimmen Annahme. Für die dritte Lesung im Hauptausschuß legte der Redaktionsausschuß einen neuen Vorschlag folgenden Wortlauts vor:
1. Ansprüche auf Wiedereinstellung, die aus einem vor dern 8. Mai 1945 begründeten öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis hergeleitet werden, gelten mit diesem Zeitpunkt als erloschen. Auf amtlich anerkannte Verfolgte des Nationalsozialismus findet diese Vorschrift keine Anwendung.
2. Sonstige Ansprüche aus einer Beschäftigung im öffentlichen Dienst, die am 8. Mai 1945 bestand, sind durch Bundesgesetz neu zu regeln. Sie können bis zur Neuregelung nur auf Grund eines deutschen Gesetzes, das nach dem 8. Mai 1945 ergangen ist. geltend gemacht werden.
3. a. Soweit nach den Vorschriften der Reichsversicherung, des Angestelltenversicherungsgesetzes oder des Reichsknappschaftsgesetzes für Personen, die nach Absatz 1 aus dem öffentlichen Dienst als ausgeschieden gelten, eine Pflicht zur Nachentrichtung von Beiträgen besteht, gelten die noch zu entrichtenden Beiträge bis zu der in Absatz 2 vorgesehenen Neuregelung als gestundet.
In der Erläuterung dazu wurde bemerkt, daß durch diese Vorschrift Ansprüche erfaßt würden, die am 8. Mai 1945 bestanden und sich auf eine Beschäftigung im öffentlichen Dienst vor dem 8. Mai 1945 gründen, gleichgültig ob das Dienstverhältnis am 8. Mai 1945 oder vor diesem Zeitpunkt erloschen ist. Die Vorschrift erfasse nur diejenigen Ansprüche, die sich gegen den öffentlichen Dienstherrn richten, nicht aber Ansprüche, die gegen einen Dritten aus Anlaß der Beschäftigung im öffentlichen Dienst, z. B. durch Entrichtung von Beiträgen für die Sozialversicherung, erworben worden sind. Die von diesem Artikel danach betroffenen Ansprüche könnten bis zur bundesgesetzlichen Regelung überhaupt nicht und dann nur nach deren Maßgabe geltend gemacht werden, es sei denn, daß eine Neuregelung in einem Lande oder einer bizonalen Verwaltung durch Gesetz erfolgt sei…. Durch den Artikel seien auch alle Ansprüche auf Wiedereinstellung erloschen, soweit sie nicht durch ein nach dem 8. Mai 1945 ergangenes Gesetz neu begründet worden seien.
Der Fünfer-Ausschuß schloß sich indes diesem Vorschlage nicht an, sondern verblieb bei dem Beschluß des Hauptausschusses zweiter Lesung, regte jedoch gesonderte Abstimmung über den letzten -die Sperrklausel enthaltenden -Satz an.
In der dritten Lesung des Hauptausschusses (51. Sitzung) beantragte der Abg. Dr. Lehr (CDU) Streichung des letzten Satzes; ihm widersprach der Abg. Dr. Schmid (SPD) mit der Begründung, dadurch würden Verhältnisse geschaffen, die man nicht fördern sollte: „Man sollte darum bis zur bundesgesetzlichen Regelung der Materie ein Justitium schaffen, man sollte die Betroffenen auf die Zeit verweisen, in der das Gesetz ergangen sein wird. Es wird ihnen nichts verloren gehen, worauf sie einen legitimen Anspruch haben sollten“. Nachdem der Abg. Dr. Hoch (SPD) darauf aufmerksam gemacht hatte, daß der Terminus, „Vertriebene“ richtigerweise durch den Ausdruck „Flüchtlinge und Vertriebene“ ersetzt werden müsse, wurde der Artikel angenommen, in gesonderter Abstimmung der letzte Satz mit zwölf gegen acht Stimmen.
In den interfraktionellen Besprechungen vor der vierten Lesung im Hauptausschuß wurde von dem Abg. Dr. Lehr (CDU) wiederum, gegen den Widerspruch des Abg Zinn (SPD), die Streichung der Sperrklausel beantragt. Von dem Abg. Dr. von Brentano (CDU) wurde der Antrag Dr. Lehr dahingehend erläutert, daß es, wenn der vorgeschlagene Satz gestrichen werde, den Ländern unbenommen bleibe, ihrerseits eine entsprechende Bestimmung zuzulassen. In der amerikanischen Zone gebe es keine Rechtsvorschrift, derzufolge den im Entnazifizierungsverfahren Entlassenen ein Rechtsanspruch zustehe. Gegenüber einem Einwand des Abg. Dr. Greve (SPD) hob der Abg. Dr. von Brentano (CDU) nochmals hervor, bei Streichung der Bestimmung bleibe es in jedem Falle den Ländern überlassen, den Beamten einen Rechtsanspruch einzuräumen oder nicht.
Der Hauptausschuß lehnte jedoch in seiner 67. Sitzung (vierte Lesung) gleichlautende Streichungsanträge der CDU/CSU und DP mit elf gegen zehn Stimmen ab, desgleichen wurde ein Streichungsantrag des Abg. Dr. Seebohm (DP), den er insbesondere mit einem Hinweis auf die vertriebenen Beamten und heimkehrenden Kriegsgefangenen begründete, vom Plenum in zweiter Lesung (9. Sitzung vom 6. Mai 49) abgelehnt.
Der Artikel 131 ist nicht nur rechtstheoretisch von großem Interesse, ihm kommt auch bereits in der Rechtspraxis steigende Bedeutung zu. So geht das schleswig-holsteinische Oberlandesgericht in einem Urteil vom 12. 7.1949 -Az. 2 U 26/49 (vgl. jetzt DRZ. 1949, 476) -mit Recht davon aus, daß der Begriff „Ausscheiden“ auch in einem rein tatsächlichen Sinne zu verstehen sei; das gehe sowohl aus dem Wortlaut wie aus dem offenkundigen Zweck dieser Vorschrift hervor: „In der Westzone leben hunderttausende Beamte und Angestellte, die durch Flucht, Kriegsgefangenschaft, Entnazifizierung, die Neugestaltung der Länder, die Zonenziehung, die Beseitigung von staatlichen Einrichtungen usw. Stellung und Gehalt verloren haben und bisher nicht ihrer bisherigen Stellung entsprechend besoldet werden. Alle solche Personen werden von dem Wort ,ausgeschieden‘ umfaßt, sofern es den tatsächlichen Zustand bezeichnet“.
Weiter heißt es in dem Urteil mit Bezug auf den Schlußsatz des Artikels: „Diese Bestimmung schließt z.Zt. den Rechtsweg für Rechtsansprüche des im Satz 1 bezeichneten Personenkreises ,vorbehaltlich anderweitiger landesrechtlicher Regelung‘ aus. Inhalt und Sinn dieses Schlußsatzes ergeben sich ebenfalls aus Wortlaut und Sinn wie aus den Gesetzesmaterialien. Der Schlußsatz des Artikels 131 sagt mit anderen Worten: ,Der Rechtsweg für die Ansprüche der bezeichneten Personen ist ausgeschlossen, die Länder können ihn jedoch zulassen. Es ist also nach Erlaß des Grundgesetzes ein neues Landesgesetz erforderlich, das den Rechtsweg entgegen der Bestimmung des Grundgesetzes eröffnet, und es kann nicht etwa aus dem Umstand allein, daß das Landesrecht beim Inkrafttreten des Grundgesetzes bereits die Rechtsverhältnisse der bezeichneten Personen vollständig oder teilweise geregelt hatte, der Schluß gezogen werden, daß schon darin eine Zulassung des Rechtsweges liegt. Denn dann hätte der Schlußsatz nicht lauten müssen: ,vorbehaltlich anderweitiger landesrechtlicher Regelung‘, sondern ,vorbehaltlich landesrechtlicher Regelung‘ oder ,bis zum Inkrafttreten des Bundesgesetzes verbleibt es bei etwaiger landesrechtlicher Regelung‘.“
Prima facie scheint diese Beweisführung einleuchtend zu sein und vieles für sich zu haben, insbesondere auch den Interessen des betroffenen Personenkreises verhältnismäßig am besten zu entsprechen, weil sie darauf hinausläuft, den Betroffenen ihre Rechte ,an sich‘ zu belassen bzw. das rechtlich relevante Vorhandensein dieser Rechte dahingestellt bleiben läßt und lediglich deren gerichtliche Geltendmachung ausschließt. Gleichwohl wird diese Argumentation der Rechtslage nicht gerecht; sie mißversteht vor allem die Intention des Verfassungsgesetzgebers. Auszugehen ist zunächst bei allen Erwägungen von dem Gesichtspunkt, der, wenn auch unausgesprochen, auch dem Kieler Urteil zugrunde liegt: Auf keinen Fall sollten die Rechte der Betroffenen etwa endgültig beseitigt (aufgehoben) werden. Unrichtig aber ist es einmal, dem Begriff „geltendmachen“ eine ausschließlich formell-rechtliche Bedeutung beizumessen: „Ausschluß des Rechtsweges“, und zum zweiten, unter „anderweitiger landesrechtlicher Regelung“ nur ein nach Inkrafttreten des Grundgesetzes neu ergehendes, den Rechtsweg ausdrücklich zulassendes Landesgesetz zu verstehen. Schon rein logisch ist der Begriff „geltendmachen“ nicht identisch mit „Beschreiten des Rechtsweges“ sondern der weitergehende Begriff.
Richtig erscheint demgegenüber die Annahme einer zeitlich befristeten Suspension dieser Rechte mit der Rechtsfolge, daß bis zum Erlaß des Bundesgesetzes kein Angehöriger des unter diese Bestimmung fallenden Personenkreises sich auf die Rechte berufen kann. Nur so kann der Zweck erreicht und einer Rechtsverwirrung vorgebeugt werden: ein derartiges Recht kann z. B. vor Gericht auch dann nicht geltend gemacht werden, wenn die Frage des Rechtsweges überhaupt keine Rolle spielt. So könnte in einem Verfahren wegen unberechtigter Titelführung z. B. ein früherer Ministerialrat des Reichspropaganda-Ministeriums slch nicht auf ein Recht zur Führung des Titels berufen.
Die Suspension bedeutet eine nur vorübergehende Außerkraftsetzung. Die außer Kraft gesetzten Rechte sind z. Zt. nicht mehr „geltendes“ Recht; es kommt ihnen z. Zt. keine Rechtswirksamkeit zu. Das ist der Sinn und Zweck der „Sperrklausel“. Die Suspension ist eine nur bedingte; sie tritt nur ein, sofern es sich bei den Rechtsansprüchen des von dieser Bestimmung umfaßten Personenkreises um solche handelt, die ihre Anspruchsgrundlage -im materiell recht.ichen Sinne gesehen -ausschließlich in dem vor dem 8. Mai 1945 geltenden Rechtszustand bzw. einem darauf beruhenden rechtsbegründenden Akt irgendwelcher Art finden. Eine Suspension tritt dagegen nicht ein, sofern es Ansprüche sind, die unmittelbar oder mittelbar in einer nach dem 8.6.1945 neu ergangenen landesrechtlichen Norm wurzeln. Gleichgültig ist dabei, ob eine solche Norm früher begründete Ansprüche als noch in altem Umfang fortbestehend anerkennt oder sie irgendwie neu regelt oder unter Negierung alter Ansprüche an deren Stelle völlig neue schafft.
Es ist unzweifelhaft, daß bei dem Passus „vorbehaltlich anderweitiger landesrechtlicher Regelung“ nicht an eine formell-rechtliche, den Rechtsweg eröffnende Bestimmung, sondern an Vorschriften materiell-rechtlichen Inhalts gedacht ist. Aus dieser Tatsache ergibt sich auch eindeutig die dem Wort. „anderweitig“ richtigerweise zukommende Bedeutung. Dieses Wort ist, entgegen der Auffassung des Oberlandesgeriehts Kiel, gedanklich überhaupt nicht auf die angeordnete „Nichtgeltendmachung“ -und damit auch nicht auf den darin unzutreffenderweise erblickten Ausschluß des Rechtsweges -zu beziehen. Es besagt vielmehr: vollgeltendes Recht sollen -bis zum Erlaß des Bundesgesetzes -Ansprüche des in Frage kommenden Personenkreises nur sein, sofern sie sich auf einschlägige landesrechtliche Vorschriften und damit auf eine „andere“ (nämlich andere als die am 8. Mai 1945 vorhanden gewesene) Anspruchsgrundlage stützen.
Davon ganz abgesehen, könnte bei einer Auslegung der Bestimmung im Sinne des Verbotes der Zulässigkeit des Rechtsweges der damit verfolgte Zweck unter Umständen deshalb überhaupt nicht erreicht werden, da z. B. in der britischen Zone eine verwaltungsrechtliche Generalklausel durch Bestimmung der Militärregierung, die Verordnung 165, geschaffen worden ist.
Da nicht die Eröffnung des Rechtsweges, sondern die materiell-rechtliche Anspruchsbegründung in Frage steht, kann es auch. nicht darauf ankommen, ob die entsprechende landesrechtliche Vorschrift bereits vor Inkrafttreten des Grundgesetzes ergangen ist oder erst später erlassen wird. Beide Möglichkeiten können gleichermaßen gegeben sein. Es war sogar vorübergehend im Redaktionsausschuß in Aussicht genommen, beide möglichen Fälle in der Gesetzesfassung gesondert zum Ausdruck zu bringen, und zwar differenzierend in der Weise, daß seitherige Vorschriften landesrechtliche Normen aller Art hätten sein können, während eine künftige Normierung nur durch Erlaß eines formellen Gesetzes hätte erfolgen dürfen. Von dieser Differenzierung wurde jedoch, vor allem um etwaige ünnötige politische Schwierigkeiten zu vermeiden, Abstand genommen. Davon abgesehen würde es eine untragbare und von keiner Seite beabsichtigte Benachteiligung der Betroffenen sein, wenn sie in jedem Falte zunächst einmal den Erlaß eines neuen Landesgesetzes abwarten müßten.
Auch aus der Entstehungsgeschichte ergibt sich eindeutig, daß mit landesrechticher Regelung die Regelung bzw. die Neuschaffung von Rechtsansprüchen im materiell-rechtlichen Sinne gemeint ist. Es sei erinnert an die bereits erwähnte Bemerkung des Abg. Zinn (SPD) in der 40. Sitzung des Hauptausschusses, im Interesse der Beamten müsse bis zum Erlaß des Bundesgesetzes das in Kraft bleiben, was landesgesetzlich geregelt sei. In der gleichen Sitzung wies der Abg. Dr. Becker (FDP) auf eine in der amerikanischen Zone bereits getroffene Regelung hin und bemerkte, Ansprüche vermögensrechtlicher Art müßten geltend gemacht werden können, „soweit sie auf dem Wege der Landesgesetzgebung neugeschaffen sind“. Sehr klar wurde dieser Gedanke zum Ausdruck gebracht in der bereits erwähnten Fassung des Redaktionsausschusses in dem Vorschlag vom 25.1.1949, derzufolge Ansprüche nur auf Grund eines nach dem 8. Mai 194; ergangenen deutschen Gesetzes geltend gemacht werden könnten, sowie in der ebenfalls bereits zitierten Aeußerung des Abg. Dr. von Brentano (CDU), „es möge den Ländern überlassen bleiben, den Beamten einen Rechtsanspruch einzuräumen oder nicht“.
Artikel 132 (Möglichkeit besonderer Maßnahmen gegenüber Richtern, Beamten usw. während einer Uebergangszeit):
In seiner 18. Sitzung hatte der Organisationsausschuß eine Bestimmung folgenden Wortlauts geschaffen:
Bei der Abwicklung der zonalen und bizonalen Behörden kann die Bundesregierung von den Bestimmungen des Beamtenrechts abweichen. Diese Befugnis endet sechs Monate nach Inkrafttreten des Grundgesetzes.
Diese Bestimmung fand von vornherein heftigen Widerstand. In der Oeffentlichkeit wurde geltend gemacht, daß es weder unter personalrechtlichen noch unter allgemein staatspolitischen Gesichtspunkten vertretbar sei, durch eine Ausnahmebestimmung im Grundgesetz die Beamtenvorschriften zu durchlöchern. Der Abg. Dr. Strauß (CDU) wies bei der Beratung darauf hin, die notwendigen organisatorischen Maßnahmen könnten auch ohne eine derartige Ermächtigung getroffen werden; die im geltenden Recht gegebenen Möglichkeiten reichten durchaus aus, um allen Erfordernissen eines neuen Verwaltungsaufbaues gerecht zu werden.
Der Redaktionsausschuß schlug unter dem 18.11.1948 eine mehr ins einzeln gehende Regelung folgender Art vor:
1. Angehörige der in Artikel 143 a Absatz 1 (jetzt Artikel 130, Absatz 1) bezeichneten Stellen, die sich in einem Rechtsverhältnis nach dem deutschen Beamtengesetz vom 26. Januar 1937 befinden, sind mit allen sich aus diesem Gesetz ergebenden Rechtsfolgen Beamte auf Widerruf. Jedoch findet § 30 Absatz 2 des deutschen Beamtengesetzes keine Anwendung.
2. Angehörige der in Artikel 143 a Absatz 1 bezeichneten Stellen, die sich in einem Rechtsverhältnis anderer Art befinden, werden wie Beamte auf Widerruf nach Maßgabe des Absatz 1 behandelt.
3. Widerruf, Ruhestandsversetzung, Beförderung, Kündigung oder eine sonstige dienstrechtliche Maßnahme kann nur von der zuständigen obersten Bundesbehörde ausgesprochen werden; diese kann ihre Befugnisse auf nachgeordnete Stellen übertragen.
4. Verwaltungsangehörige im Sinne dieser Bestimmung sind auch die Mitglieder des Verwaltungsrates des Vereinigten Wirtschaftsgebietes.
Der Ausschuß hatte gegen die vom Organisationsausschuß vorgeschlagene Formulierung inbesondere deshalb Bedenken, weil damit der Bundesregierung eine schlechthin unbegrenzte Vollmacht eingeräumt und für die Uebergangszeit eine starke Rechtsunsicherheit entstehen würde. Auch müsse bei der Regelung auf die bei diesen Behörden zahlreich vorhandenen Angestellten irgendwie Rücksicht genommen werden.
Der Vorschlag des Redaktionsausschusses wurde vom Organisationsausschu8 in seiner 27. Sitzung debattiert, gleichzeitig mit der Frage der Beibehaltung seines eigenen früheren Vorschlages. Der Abg. Dr. Lehr (CDU) erklärte: „Wir lehnen sowohl diese Fassung wie die Fassung des Redaktionsausschusses grundsätzlich ab…. Wir sind der Meinung, daß die bisherigen Rechtsvorschriften ausreichen und daß die Gelegenheit der Schaffung einer Verfassung nicht dazu benutzt werden sollte, das Beamtenrecht grundsätzlich umzugestalten…..“. Er wies darauf hin, daß in allen Frankfurter Stellen zusammengenommen lediglich ca. 800 Beamtenplanstellen vorhanden und davon ca. 300 tatsächlich mit Beamten besetzt seien. Im Hinblick darauf sei eine besondere Verfassungsbestimmung überflüssig. Auch der Abg. Dr. Dehler (FDP) sah in der Vorschrift einen „Rechtsbruch und eine Ausnahmegesetzgebung“. Für die Beibehaltung traten die Abgeordneten der SPD (Heiland, Schönfelder, Kuhn) und des Zentrums (Frau Wessel) ein. Eine Entscheidung durch Mehrheitsbeschluß konnte nicht herbeigeführt werden.
Die gleiche Frontenstellung trat zutage in der ersten Lesung des Hauptausschusses (20. Sitzung). Der Abg. Dr. Lehr (CDU) bezeichnete als Berichterstatter einen wesentlichen Abbau „im gesamten Bereich des deutschen Behördenwaldes“ als unbedingt erforderlich; die Frage sei nur, ob dies durch Sonderbestimmung oder mit den bisher gültigen Gesetzen erfolgen solle. Der Abg. Dr. Seebohm (DP) regte an, einen Unterschied zwischen den zonalen Stellen, für die deutsches Beamtenrecht nicht ohne weiteres gelte, und den bizonalen Stellen, zu machen. Von dem Abgeordneten Zimmermann (SPD) wurde betont, es handele sich nicht um ein Anti-Beamtengesetz, aber es müsse der Belastung mit einer Hypothek personeller Art vorgebeugt werden. Die Regierung müsse die Möglichkeit und freie Hand haben, sich eine Beamtenschaft neu aufzubauen. Der Abg. Dr. Schmid (SPD) bemerkte, ebensowenig wie eine geschlossene Uebernahme des Frankfurter Beamtenkorps in Frage komme, könnten die jetzt in den Länder-Instanzen der französischen Zone mit Aufgaben des künftigen Bundes beschäftigten Beamten tel quel übernommen werden. Der Abg. Dr. Greve (SPD) wollte die Ermächtigung der Bundesregierung auf einen längeren Zeitraum ausgedehnt wissen. Demgegenüber bezeichnete der Abg. Kaufmann (CDU) die in der Oeffentlichkeit gemeinhin herrschenden und immer wieder genährten Auffassungen hinsichtlich der Zustände bei den Frankfurter Verwaltungsstellen als stark übertrieben. Der Abg. Dr. Lehr (CI)U) betonte nochmals, die erforderliche Freiheit des Handelns sei auch mit den bestehenden Gesetzen zu erzielen, es bedürfe nicht der Hilfe eines Gewaltaktes. Der Abg. Dr. Süsterhenn (CDU) meinte, es sei am Platze, mißbräuchlichen „Torschlußakten“ entgegenzutreten, z. B. soweit es sich um die Neubegründung von Beamtenverhältnissen nach dem 1. September 1848 handele. In der Abstimmung wurde indes die völlige Streichung des Artikels mit elf gegen zehn Stimmen beschlossen.
Einen neuen Vorstoß in Gestalt eines neuen Vorschlages, der an die Spitze eine Bestimmung ganz generellen Charakters gestellt sehen wollte, machte der Redaktionsausschuß (unter dem 16.12.1948) für die zweite Lesung des Hauptausschusses:
1. Auf Lebenszeit angestellte Beamte und Richter können bis zum 1. Januar 1950 auch vor Erreichung einer gesetzlich vorgeschriebenen Altersgrenze in den Ruhestand versetzt werden. Auf in einem unkündbaren Arbeitsverhältnis stehende Angestellte findet diese Vorschrift entsprechende Anwendung
2. Angehörige der in Artikel 143 a Absatz 1 (jetzt Artikel 130) bezeichneten Stellen können sich auf die Rechte, die ihnen nach dem 1. September 1948 eingeräumt worden sind, hinsichtlich der Beendigung ihres Dienstverhältnisses, nicht berufen.
3. Das Dienst- oder Arbeitsverhältnis eines Angehörigen der in Artikel 143 a Absatz 1 bezeichneten Stellen, der nach dem 1. September 1948 in den Dienst der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes neu überwiesen worden ist, kann mit einer Frist von sechs Wochen zum Schluß des Kalendervierteliahres gekündigt werden, falls nicht eine für die Anstellungsbehörde günstigere Kündigungsfrist vereinbart worden ist.
4. Absatz 2 und 3 finden auf die den Zentralverwaltungen des Vereinigten Wirtschaftsgebiets unterstehenden Sonderverwaltungen (Deutsche Reichsbahn des Vereinigten Wirtschaftsgebiets, Deutsche Post usw.) und die entsprechenden Verwaltungen des französischen Besatzungsgebiets keine Anwendung.
Die vom Redaktionsausschuß gegebenen Anregungen waren Gegenstand eingehender Beratungen des Organisationsausschusses in seiner 30. Sitzung. Dabei brachte der Abg. Dr. Katz (SPD) zum Ausdruck, er halte eine vorzeitige Zurruhesetzung von Richtern in der britischen Zone für dringend erforderlich im Hinblick auf die Art und Weise, wie die Besatzungsmächte in vielen Fällen bei Anstellungen verfahren seien. Der Abg. Dr. Fecht (CDU) vertrat den gleichen Standpunkt: „Als Justizûninister von Baden muß ich mich auf den gleichen Standpunkt stellen wie der Kollege aus Schleswig-Holstein. Durch das merkwürdige Entnazifizierungsverfahren, das zum Teil doch geradezu unglaubliche Ergebnisse gezeitigt hat, standen wir unter dem Zwang, Leute wieder einzustelen, die wir keinesfalls für geeignet gehalten haben, als Richter zu fungieren -Leute, die durch ihr Auftreten zum Teil Aergernis erregt haben. Ich würde es von meinem Standpunkt aus begrüßen, wenn ich die Möglichkeit hätte den einen oder anderen von diesen Leuten durch Zurruhesetzung wieder zu entfernen“. Auch der Abg. Dr. Mücke (SPD) hielt eine entsprechende Vorschrift für erforderlich im Hinblick auf die „ganz klaren Ansprüche“ früherer auf Lebenszeit angestellter Beamten gegen den Bund. Der Abg. Dr. Süsterhenn (CDU) wollte den Kreis der betroffenen Richter und Beamten irgendwie begrenzt wissen, etwa auf politisch belastete Personen, da es nicht angängig sei, daß auch jeder Unbelastete einfach pensioniert werden könne. Auch der Abg. Dr. Lehr (CDU) setzte sich für eine Begrenzung des von dieser Vorschrift umfaßten Personenkreises ein: nach der vorliegenden Fassung könne ein Beamter jederzeit ohne Frist in den Ruhestand versetzt werden. Wenn er dann die gesetzlichen Mindestvoraussetzungen für die Gewährung des Ruhegehalts nicht habe, werde er ohne irgendwelche materiellen Ansprüche entlassen. Dadurch werde für die Beamten auf Lebenszeit, und vor allem für die unkündbaren Angestellten eine ungünstigere Rechtslage geschaffen, als für diejenigen, die auf Widerruf oder als kündbare Angestellte eingestellt worden seien. Ministerialdirektor Dr. Ringelmann brachte zum Ausdruck, die Bestimmung dürfe sich nur beziehen auf Richter und Beamte, die die persönlichen und fachlichen Voraussetzungen ihres Amtes nicht erfüllten. Der Abg. Dr. Dehler (FDP) erläuterte die Ratio des Vorschlages des Redaktionsausschusses dahin, daß „diese Bestimmung nur wegen der Verhältnisse in der britischen Zone, besonders in der Justiz“, aufgenommen worden sei.
Der vom Organisationsausschuß eingesetzte Unterausschuß ließ zwar den mit der Vorschrift verfolgten Grundgedanken bestehen, gab aber dem Vorschlag des Redaktionsausschusses eine neue Fassung, in der insbesondere die Rechtsverhältnisse der Beamten und unkündbaren Angestellten in einem besonderen (zweiten) Absatz behandelt wurden. Auf der Grundlage dieser Neufassung wurde der Fragenkomplex vom Organisationsausschuß, in seiner 31. Sitzung nochmals durchberaten, wobei von Dr. Ringelmann zu den einzelnen Fragen die notwendigen Erläuterungen gegeben wurden. Die Frist für Maßnahmen gegenüber Angehörigen der in Artikel 130 bezeichneten Stellen wurde auf sechs anstatt der zunächst vorgesehenen drei Monate bemessen und dabei der vorgesehene Stichtermin -1. Sepemtber 1948 -gestrichen, nachdem der Abg. Dr. Katz (SPD) unter Zustimmung des Abgeordneten Kaufmann (CDU) zu bedenken gegeben hatte, daß vielfach gerade die in der ersten Zeit eingestellten Verwaltungsangehörigen den meisten Anlaß zu Beanstandungen böten. Zusätzlich wurde die Möglichkeit des Widerrufs von Beförderungen und Zusicherungen vermögensrechtticher Art bei diesem Personenkreis vorgesehen, obwohl nach der Feststellung des Abg. Kaufmann (CDU) etwa von einer nach „Korruption riechenden“ Beförderungsart überhaupt keine Rede sein könne. Dagegen verfiel der Ablehnung ein Antrag des Abg. Heiland (SPD), der festlegen wollte:
Ernennungen und Beförderungen nach dem 1. September 1948 sind rechtsunwirksam.
In der zweiten Lesung des Hauptausschusses (40. Sitzung) trat der Abg. Zinn (SPD) dafür ein, die im Absatz 1 neu eingefügten Worte „…..die persönlichen und fachlichen Voraussetzungen ihres Amtes nicht erfüllen…..“ zu streichen; seiner Meinung nach müsse man dem Bund nicht nur die Möglichkeit geben, alle diejenigen abzubauen oder zu pensionieren, die mit Rücksicht auf ihre Person den zu stellenden Anforderungen nicht genügten, sondern solle einen Abbau auch ermöglichen, wenn es aus Gründen der Verwaltungsreform oder des Neuaufbaus der Verwaltung nötig sei. Der Abg. Dr. Lehr (CDU) setzte sich demgegenüber für Beibehaltung der in diesem Passus aufgestellten -einschränkenden -Voraussetzungen für alle etwa vorzunehmenden Abbaumaßnahmen ein. Auf Antrag des Abg. Renner (KPD) wurde mit elf gegen zehn Stimmen beschlossen, daß die im Absatz 1 vorgesehenen Maßnahmen sich nicht auf politisch Verfolgte erstrecken dürften. Mit dieser Aenderung wurde die vom Organisationsausschuß vorgeschlagene Fassung vom Hauptausschuß akzeptiert.
In seinen Vorschlägen für die dritte Lesung des Hauptausschusses wies der Redaktionsausschuß darauf hin, die vorgesehene Bestimmung sollte die Möglichkeit geben, den Personalbestand aller öffentlichen Verwaltungen unter persönlichen und fachlichen Gesichtspunkten, die bei dem Aufbau einer neuzeitlichen Verwaltung zu berücksichtigen seien, einer Auslese zu unterziehen und ihn an die Veränderung der Zuständigkeiten und Aufgaben anzupassen. Zu diesem Zweck dürfte es genügen, wenn es ermöglicht würde, auf Lebenszeit angestellte Richter und Beamte vorzeitig in den Ruhestand, in den Wartestand oder auch in ein anderes Amt, auch mit geringerem Rang und Diensteinkommen, zu versetzen. Dadurch könnten auch Anstellungen der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes einer ausreichenden Korrektur unterzogen werden. Einer diesbezüglichen Sondervorschrift bedürfe es deshalb überhaupt nicht. Die Regelung, die insoweit vom Hauptausschuß in zweiter Lesung getroffen worden sei, gehe überdies sehr weit und greife in Dienstverhältnisse ein, deren Gestaltung zu ändern keine grundsätzliche Veranlassung bestehe. Auf der anderen Seite wollte allerdings der Redaktionsausschuß die Eingriffsmöglichkeiten insofern erweitern, als er nicht das Fehlen der persönlichen bzw. fachlichen Eignung zum gesetzlichen Tatbestandsmerkmal machen, sondern lediglich ohne unmittelbare Rechtswirkung -einen allgemeinen Hinweis in dieser Richtung mit in die Motivation zu dieser Vorschrift aufnehmen wollte.
Aus dieser Erwägung ging der Vorschlag des Redaktionsausschusses dahin:
Zum Aufbau eines neuzeitlichen, allen persönlichen und fachlichen Anforderungen genügenden öffentlichen Dienstes und zur Anpassung seines Personalbestandes an die Aenderung der Zuständigkeiten und Aufgaben der öffentlichen Verwaltung können im Bund, in den Ländern und allen anderen Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts bis zum 31. Dezember 1950
1. Richter und Beamte auf Lebenszeit in den Ruhestand oder in den Wartestand oder in ein anderes Amt, auch geringeren Ranges und mit geringerem Diensteinkommen, versetzt werden;
2. Richter und Beamte auf Kündigung, Widerruf oder Probe in den Ruhestand, in ein anderes Amt, auch geringeren Ranges und mit einem geringeren Diensteinkommen, versetzt werden, falls ihr Dienstverhältnis nicht nach dem für sie geltenden Recht gelöst wird;
3. Angestellte und Arbeiter mit einer Kündigungsfrist von längstens sechs Wochen zum Schluß eines Kalenderviertellahres gekündigt werden. In den Fällen, in denen eine längere Kündigungsfrist vereinbart war, oder als vereinbart galt, oder in denen eine Kündigung ausgeschlossen war, kann die Abfindung und Versorgung durch Gesetz geregelt werden.
Der Hauptausschuß hielt indes in dritter Lesung (51. Sitzung), einem Vorschlag des Fünfer-Ausschusses folgend, an der Scheidung zwischen einer auf alle Beamten- und Richterkategorien anwendbaren allgemeinen Regelung (Absatz 1) und einer zusätzlichen Sonderregelung für Angehörige der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebiets (Absätze 2 und 3) fest. Letztere wurde jedoch gegenständlich stark eingeengt: durch Fortfall des Widerrufrechts für Dienstverhältnisse von Beamten und unkündbaren Angestellten sowie Ausscheidung aller vor dem 30. 9. 1948 liegenden Fälle aus dem Tatbestand des Absatz 2.
Die Fassung der Vorschrift lautete nunmehr:
1. Beamte und Richter, die im Zeitpunkt des Inkrafttreten dieses Grundgesetzes auf Lebenszeit angestellt sind, können bei Fehlen persönlicher und fachlicher Eignung für ihr Amt binnen sechs Monaten nach dem ersten Zusammentritt des Bundestages in den Ruhestand oder Wartestand oder in ein anderes Amt mit geringerem Diensteinkommen versetzt werden. Auf in einem unkündbaren Dienstverhältnis stehende Angestellte findet diese Vorschrift entsprechende Anwendung.
2. Unbeschadet des Absatz 1 können binnen sechs Monaten nach dem ersten Zusammentritt des Bundestages bei Angehörigen der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes nach dem 30. September 1948 ausgesprochene Beförderungen und Zusicherungen vermögensrechtlicher Art vom zuständigen Bundesininister widerrufen werden.
3. Das Dienstverhältnis eines nichtbeamteten Angehörigen der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes kann binnen 6 Monat. nach dem ersten Zusammentritt des Bundestages mit tarifmäßiger Kündigungsfrist auch in den Fällen gekündigt werden, in denen eine für Verwaltungsangehörige günstigere Kündigungsfrist vereinbart wurde.
4. Diese Bestimmungen finden keine Anwendung auf Personen, die von den Säuberungsgesetzen nicht betroffen oder die anerkannte Opfer des Nationalsozialismus sind.
5. Absatz 2 und 3 finden auf die den Zentralverwaltungen des Vereinigten Wirtschaftsgebiets unterstehenden Sonderverwaltungen (Deutsche Reichsbahn im Vereinigten Wirtschaftgebiet, Deutsche Post usw.) und die entsprechenden Verwaltungen des französischen Besatzungsgebietes keine Anwendung.
6. Das Nähere bestimmt eine Anordnung der Bundesregierung.
In den Anfang Mai stattgefundenen interfraktionellen Besprechungen setzte sich der Abg. Dr. Greve (SPD) dafür ein, als Stichtermin im Absatz 1 nicht den 30., sondern den 1. September 1948 zu bestimmen; von diesem Zeitpunkt -dem Tag des Zusammentritts des Parlamentarischen Rates -an, hätten die Frankfurter Organisationen wissen müssen, daß sich der Aufbau eines neuen Staatsgebildes anbahne, der ihre Befugnisse zu übernehmen habe; sie hätten daher von diesem Tage an keine die künftigen Bundesorgane bindenden Verpflichtungen übernehmen durfen. Der Abg. Kaufmann (CDU) erklärte diese Auffassung für irrig; es sei ursprünglich nicht einmal der 30. September, sondern erst der 1. Dezember 1948 vorgesehen gewesen. Die Richtigkeit dieser Erklärung wurde bestätigt von den Abgeordneten Dr. Menzel (SPD) und Brockmann (Z). Der Abg. Dr. Seebohm (DP) regte an, in Absatz 4 von „Beseitigung des Nationalsozialismus…..“ zu sprechen. Der Abg. Dr. von Brentano (CDU) kündigte an, seine Fraktion werde die Streichung des Absatz 4 beantragen. Es sei selbstverständlich daß man gegenüber dem in Absatz 4 umschriebenen Personenkreis von der Möglichkeit der Kündigung keinen Gebrauch machen werde, soweit nicht zwingende Gründe vorlägen. Das könne man bei sämtlichen Regierungen ohne weiteres voraussetzen. Man solle aber nicht eine solche Vorschrift, die auch für die davon Betroffenen selbst einen unangenehmen Beigeschmack habe, in das Grundgesetz hineinnehmen. Zur Sprache kamen auch die aus dem Militärregierungsgesetz Nr. 15 sich ergebenden weiteren „Verbeamtungen“ bei den Frankfurter Institutionen.
In der vierten Lesung des Hauptausschusses (57. Sitzung) wurden Anträge des Abg. Kaufmann (CDU) auf Streichung der Absätze 2, 3 und 5 abgelehnt, wie auch gleichlautende Anträge der Abg. Dr. Pfeiffer (CSU) und Dr. Seebohm.(DP) den Absatz 4 zu streichen, die letzteren mit elf gegen zehn Stimmen. Desgleichen verfiel der Antrag des Abg. Dr. Seebohm (DP) der Ablehnung, der die Maßnahmen des Absatz 1 nur bis zum 1. Januar 1950 vorsehen und sie nur dann für zulässig erklären wollte, wenn im Einzelfall der Mangel persönlicher und fachlicher Eignung nachgewiesen werden könne, und der über das Vorliegen dieser Voraussetzungen den zuständigen Disziplinarvorgesetzten entscheiden lassen wollte. Dagegen wurde auf Antrag des Abg. Zinn (SPD) die Voraussetzung des Fehlens der erforderlichen Eigaung nicht kumulativ, sondern alternativ (persönlich oder fachlich) gefaßt. Ein weiterer SPD-Antrag, den Zeitraum für die nach Absatz 1 möglichen Maßnahmen auf ein Jahr zu erstrecken, wurde mit zehn gegen neun Stimmen abgelehnt. Zu Absatz 2 wurde der Antrag des Abg. Dr. Greve(SPD), das Datum „30. September“ in „1. September“ abzuändern, abgelehnt, jedoch angenommen der Antrag desselben Abgeordneten, wonach die Widerrufbefugnis ausgeübt werden könne „von der Bundesregierung oder dem zuständigen Bundesminister“. Vorher war ein Antrag des Abg. Dr. Seebohm (DP), jeden Widerrufsakt von einem „Beschluß der Bundesregierung“ abhängig zu machen, abge!ehnt worden. Das gleiche Schicksal erlitt ein Antrag des Abg. Dr. Seebohm (DP), der die nähere Regelung einem Bundesgesetz (und nicht einer Verordnung der Bundesregierung ) übertragen wollte.
Der Absatz 4 erhielt auf Antrag des Abg. Zinn (SPD) die Fassung:
Diese Bestimmungen finden keine Anwendung auf Personen, die von den Vorschriften über die Befreiung vom Nationalsozialismus und Militarismus nicht betroffen oder die anerkannte Verfolgte des Nationalsozialismus sind.
Im übrigen verblieb es bei der Fassung der dritten Lesung im Hauptausschuß. Diese Fassung wurde auch vom Plenum in der zweiten Lesung nochmals bestätigt, während die vorliegenden zahlreichen Abänderungsanträge bis zur dritten Lesung im Plenum zurückgestellt wurden. Dieses ungewöhnliche Verfahren zeigt am deutlichsten, mit welch außergewöhnlicher Zähigkeit und Hartnäckigkeit auf den verschiedenen Seiten bis zuletzt um den rechtlichen Gehalt und damit die Gestaltung des Artike!s gerungen wurde. Unter den Anträgen befand sich vor allem ein Antrag des Abg. Dr. Heuß (FDP), der Maßnahmen nach Absatz 1 bis zum 31. Dezember 1950 gestatten und einen Widerruf (Absatz 2) nur für nach dem 31. Dezember 1948 ausgesprochene Beförderungen und Zusicherungen zulassen wollte.
Für die dritte Lesung des Plenums hatte der Abg. Zinn (SPD) den Vorschlag des Redaktionsausschusses vom 25.1.1949 wiederum aufgegriffen in Form folgenden Antrages:
1. Zum Aufbau eines allen persönlichen und fachlichen Anforderungen genügenden öffentlichen Dienstes und zur Anpassung seines Personalbestandes an die Aenderung der Zuständigkeiten und Aufgaben der öffentlichen Verwaltungen können im Bund, in den Ländern und allen anderen Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts bis zum 30. Juni 1950 nach Anhörung der zuständigen Betriebsvertretung
a. Richter und Beamte auf Lebenszeit in den Ruhestand oder in den Wartestand oder in ein anderes Amt, auch geringeren Ranges und mit geringerem Diensteinkommen versetzt werden;
b. Richter und Beamte auf Kündigung, Widerruf oder Probe in den Ruhestand, in ein anderes Amt, auch geringeren Ranges und mit einem geringeren Diensteinkommen versetzt werden, falls ihr Dienstverhältnis nicht nach dem für sie ge!tenden Recht gelöst wird;
c. Angestellte und Arbeiter mit der tariflichen Kündigungsfrist, jedoch längstens einer Kündigungsfrist von sechs Monaten zum Schluß eines Kalendervierteljahres gekündigt werden. In den Fällen, in denen eine längere Kündigungsfrist vereinbart war oder als vereinbart galt, ist die Abfindung und Versorgung durch Gesetz zu regeln.
2. Diese Bestimmung findet keine Anwendung auf Angehörige des öffentlichen Dienstes, die von den Vorschriften über die Befreiung vom Nationalsozialismus und Militarismus nicht betroffen oder anerkannte Verfolgte des Nationalsozialismus sind.
Der Antrag fand keine Mehrheit, dagegen ein gemeinsamer Antrag der Abgeordneten Dr. Lehr (CDU) und Dr. Heuß (FDP), durch den der Artikel seine endgültige Fassung erhielt.
Diese endgültige Fassung folgt insofern den Vorschlägen des Redaktionsausschusses, als sie irgendeine Sonderbehandlung der Angehörigen der unter Artikel 130 fallenden Stellen, vor allem der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes, nicht mehr vorsieht, auch nicht in der Form eines eventuellen Widerrufs von Beförderungen und Zusicherungen. Andererseits lehnt sie in ihrer grundsätzlichen Zielsetzung eindeutig die Absichten jener Richtung ab, als deren Hauptwortführer der Abg. Zinn (SPD) hervorgetreten war. Ihre Ratio ist es nicht, die Handhabe dafür zu bieten, einen völlig neuartigen Verwaltungsaufbau oder eine „große Verwaltungsreform“ durchzuführen und sich ggf. uno actu in weitem Umfange mißliebiger Personen zu entledigen. Streng begrenzt auf den Charakter einer „Uebergangsbestimmung“, darf sie den verantwortlichen Stellen nur dazu dienen, während eines zeitlich befristeten Zeitraumes jeweils in Einzelfällen ausgesprochene Versager zu entfernen. Diese Zweckbestimmung muß auch die in Absatz 4 vorgesehene Verordnung haben, die übrigens zeitlich so frühzeitig ergehen müßte, daß die Maßnahmen des Absatz 1 innerhalb der dort vorgesehenen Frist ergriffen werden können.
Gemäß Absatz 2 sind die „Nichtbetroffenen“ und anerkannten Verfolgten den Maßnahmen nach Abs. 1 nicht mehr generell entzogen, ihnen aber nur unterworfen, sofern in ihrer Person zusätzlich ein „wichtiger Grund“ vorliegt. Ob ein solcher im Einzelfall gegeben ist, ist in erster Linie nach den in der Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen zu beurteilen.
Besonders hervorzuheben ist, daß nach Absatz 3 den von den Maßnahmen Betroffenen der Rechtsweg nach Artikel 19 Absatz 4 offensteht, sei es der Rechtsweg von den ordentlichen, den Verwaltungs-, oder auch den Disziplinargerichten. Soweit die Verwaltungsgerichte in Frage kommen, wird damit noch einmal klargestellt, daß der Rechtsweg vor diesen Gerichten auch im Bereich der sogen. besonderen Gewaltverhältnisse gegeben ist. Außerdem wird dokumentiert, daß es sich hier um Rechts- und nicht etwa um bloße Ermessensfragen handelt.
Die persönliche Eignung schließt auch ein die Frage der politischen Zuverlässigkeit im demokratischen Sinne. Zu diesem Punkte hatte Ministerialdirektor Dr. Ringelmann in der 31. Sitzung des Organisationsausschusses u. a. bemerkt: „…..wobei wir unter persönlichen Voraussetzungen auch die politische Tragbarkeit miteinbegreifen wollen. Wir haben, wenn ich speziell an die bayerischen Verhältnisse denke, in einer Reihe von Bestimmungen festgelegt, daß die persönlichen Voraussetzungen immer die Einordnung in den demokratischen Staat und die Bereitwilligkeit zur Mitwirkung an der Erreichung der Ziele des demokratischen Staates enthalten. Soviel ich mich erinnern kann, enthält das hessische Gesetz eine ähnliche Bestimmung. Württemberg hat diese Grundsätze auch längst übernommen. Soviel ich von Nordrhein-Westfalen gehört habe, besteht dort die Absicht, wenn sie noch nicht verwirklicht ist, auch Bestimmungen zu übernehmen oder zu schaffen, die den bayerischen Bestimmungen entsprechen. Dieser Begriff wird also wohl Allgemeingut werden“.
Eine solche Beurtei!ung und eine darauf gestützte Ergreifung von Maßnahmen nach Absatz 1 würde nicht gegen die Bestimmungen des Grundrechtsteils des Grundgesetzes verstoßen. Die Freiheit der Meinungsäußerung -und damit auch der Aeußerung politischer Anschauungen -findet ihre Grenze gemäß Artikel 5 Absatz 2 in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze. Zu diesen gehören nach anerkannter Rechtsauffassung auch die zur Regelung der besonderen Unterwerfungsverhältnisse gewisser Personenkreise erlassenen Gesetze, einschließlich der beamtenrechtlichen. Ein Beamter ist z. B. regelmäßig verpflichtet, innerhalb seiner amtlichen Tätigkeit alles zu unterlassen, was mit den Grundsätzen der Verfassung in Widerspruch steht und geeignet ist, den durch sie geschützten staatichen Interessen und Einrichtungen Abbruch zu tun.
Eine nach Absatz ergriffene Maßnahme wäre weiterhin eine „Benachteiligung“ im Sinne des Artikels 3 Absatz 3 nur dann, wenn sie bloß deshalb erfolgte, weil der davon Betroffene überhaupt eine Meinung geäußert hat; sie ist es aber nicht, wenn die Aeußerung wegen Verstoßes gegen ein „allgemeines Gesetz“ an sich unbefugt und widerrechtlich ist (vgl. Anschütz, Kommentar, 1933, S. 556).
Soweit indes das politische Verhalten eines Beamten usw. in der Zeit vor 1945 nach den einschlägigen Entnazifizierungsbestimmungen bereits gewürdigt und von den ausschließlich zuständigen Stellen darüber endgültig entschieden ist, ist nicht nur die jeweils ausgesprochene Einstufung (in eine bestimmte Gruppe) maßgeblich und bindend („Tatbestandswirkung“), sondern auch die gleichzeitig damit erfolgte Feststellung daß der Betreffende auf Grund seines Verhaltens als „Mitläufer“ usw. anzusehen ist („Feststellungswirkung“). Der gesamte einschlägige Tatbestand ist damit endgültig konsumiert. Er unterliegt nicht etwa der nochmaligen selbständigen Entscheidungskompetenz dritter Stellen, die nicht nachzuprüfen haben, ob die getroffene Feststellung zu Recht oder zu Unrecht erfolgt ist.
Bemerkenswert ist noch, daß, entgegen den früheren Vorschlägen, für die die nähere Regelung treffende Verordnung der Bundesregierung die Zustimmung des Bundesrates vorgeschrieben ist. Es handelt sich hier wie im Falle des Artikels 119 und des Artikels 127 um eine Verordnung kraft verfassungsrechtlicher Ermächtigung. Auch diese Verordnung muß gemäß Artikel 80 Absatz 1 Satz 3 diese Bestimmung des Grundgesetzes als Ermächtigungsgrundiage angeben.
Grundgesetzliche Legal-Definitionen:
Artikel 116 (Legaldefinitlon des Begriffes „Deutscher“ -Regelung der „Wiedereinbürgerung“):
Absatz 1 -„Deutscher“:
Die Frage der Staatsangehörigkeit ist im Grundgesetz in Artikel 16 nur insoweit berührt, als dort der Verlust der Staatsangehörigkeit behandelt wird. Im übrigen besagt Artikel 73, daß der Bund die ausschließliche Gesetzgebung über die Staatsangehörigkeit im Bunde hat, und nach Artikel 74 erstreckt sich die konkurrierende Gesetzgebung u. a. auf die Staatsangehörigkeit in den Ländern. Der Herrenchiemseer Entwurf erwähnte die Staatsangebörigkeit überhaupt nur im Gesetzgebungs-Katalog.
Die Weimarer Verfassung enthielt in Artikel 110 den Satz, daß jeder Angehörige eines Landes zugleich Reichsangehöriger sei. Sie hatte den im Staatsangehörigkeitsgesetz von 1913 bereits enthaltenen doppelten Begriff der Landes- und Reichsangehörigkeit übernommen. Nicht ausgeschlossen war allerdings der Erwerb der unmittelbaren Reichsangehörigkeit (z. B. für Angehörige in den Schutzgebieten), ohne daß die Betreffenden eine Landesangehörigkeit zu besitzen brauchten. „Deutscher“ war bei dieser Rechtslage, wer die Staatsangehörigkeit in einem deutschen Lande oder die unmittelbare Reichsangehörigkeit besaß.
Eine auf Grund des sogn. Neuaufbau-Gesetzes ergangene Verordnung des damaligen Ministers des Innern vom 5.2.1934 (Reichsgesetzblatt I S. 85) bestimmte: „Die Staatsangehörigkeit in den deutschen Ländern fällt fort. Es gibt nur noch eine deutsche Staatsangehörigkeit (Reichsangehörigkeit).“ Ungeachtet des Ursprunges dieser Bestimmung in der nationalsozialistischen Epoche sowie des staatlichen Zusammenbruchs im Frühjahr 1945, sind insbesondere die bisher ergangenen Gesetze und Erlasse des Kontrollrats und der Alliierten Militärbefehlshaber von der Fortgeltung des hierdurch geschaffenen Rechtszustandes ausgegangen. Demnach gibt es auch heute (nach 1945) noch Deutsche, d. h. deutsche Staatsangehörige. In zahlreichen Kundgebungen von alliierter Seite wird der Ausdruck „Deutscher“ oder „Deutscher Staatsangehöriger“ verwandt, so z. B. im Kontrollratsgesetz Nr. 8 Artikel 4 und in der Proklamation Nr. 2 Artikel 3, Befehl Nr. 1, Direktive 43, besonders aber im Kontrollratsgesetz Nr. 33, das eine Volkszählung in Deutschland angeordnet hat. Konsequente Verfechter der Rechtsansicht, daß Deutschland als Staat untergegangen sei, haben allerdings die Auffassung vertreten, daß es eine deutsche Staatsangehörigkeit nicht mehr geben könne. So ist für von Dassel (Die Frage nach dem deutschen Staat von heute, 1948 S. 40) die heute international anerkannte deutsche Staatsangehörigkeit nichts als ein „rein technischer Begriff“, um eine bestimmte Art von Staatenlosen zu bezeichnen. Demgegenüber bejaht indes auch das Grundgesetz -vgl. die Präambel -unzweideutig die Fortexistenz Deutschlands als Staat.
Im Grundgesetz war zunächst -auf Grund einer Vorlage des Grundsatzausschusses -die Aufnahme eines Satzes vorgesehen:
Jeder Staatsangehörige ist zugleich Bundesangehöriger.
Von der verfassungsrechtlich zwingenden Stipulierung eines besonderen Begriffes der „Bundesangehörigkeit“, der damit geltendes, unmittelbar anzuwendendes Verfassungsrecht geworden wäre, wurde jedoch, auf einen entsprechenden Hinweis des Redaktionsausschusses hin, mit Rücksicht auf die Ostzone Abstand genommen, wie man auch in der Frage Bundes- oder Landesangehörigkeit bzw. ggf. Bundes- und Landesangehörigkeit von verfassungswegen keinerlei Präjudiz schaffen wollte. Vielmehr sollte im Gesetzgehungskatalog lediglich die Möglichkeit der Schaffung einer besonderen Bundesangehörigkeit und einer davon geschiedenen Einzelstaatsangehörigkeit in den Ländern eröffnet werden. Zur Zeit also gibt es -das war in Uebereinstimmung mit der herrschenden Meinung offensichtlich die Auffassung der Mehrheit in den mit diesen Fragen befaßten Ausschüssen -nur eine einheitliche deutsche Staatsangehörigkeit.
In jedem Falle aber erschien eine Legaldefinition des Begriffes „Deutscher“ im Grundgesetz unumgänglich erforderlich. Neu ist bei dieser Definition die Einbeziehung der sogn. Volksdeutschen (Flüchtlinge oder Vertriebene deutscher Volkszugehörigkeit), die den „deutschen Staatsangehörigen“ gleichgestellt werden. Die Vorschrift des Artikels 116 Absatz. 1 geht zurück auf eine Anregung des Redaktionsausschusses, der auch, über den ursprünglich nur vorgesehenen Kreis der „Flüchtlinge“ hinaus, die Vertriebenen ausdrücklich mitumfaßt wissen wollte; dieser Vorschlag wurde gebilligt vom Fünfer-Ausschuß und vom Hauptausschuß in dritter Lesung gutgeheißen. Es bestand Einmütigkeit darüber, daß sich diese Vorschrift auch auf Fälle bezieht, in denen künftig volksdeutsche Flüchtlinge bzw. Vertriebene noch Aufnahme finden, und daß es auch nicht darauf ankommen soll, in welcher Zone der betreffende Volksdeutsche jetzt wohnt. Einbezogen werden auch die Ehegatten und die Abkömmlinge der Volksdeutschen. Bei diesen kann es sogar der Fall sein, daß diese von Geburt selbst nicht Volksdeutsche sind.
Absatz 2 -Regelung der „Wiedereinbürgerung“:
Diese Vorschrift beruht auf einem Vorschlag des Grundsatzausschusses, dem sich der Organisationsausschuß angeschlossen hatte.
Hier konnte eine allseits befriedigende Formulierung nur unter besonders großen Schwierigkeiten gefunden werden. Einerseits sollte der Grundgedanke zum Ausdruck kommen, daß es sich bei den nationalsozialistischen Ausbürgerungsmaßnahmen um typische Willkür-Akte eines usurpatorischen Gewaltregimes gehandelt hat. Sie waren nicht nur nicht rechtens, sondern müßten folgerichtig darüber hinaus als absolut nichtig angesehen werden. Diese Folgerung hat z B. Belgien, unter Berufung auf den darin liegenden Verstoß gegen seinen ordre publique, gezogen. Andererseits würde jedoch die ausnahmslose Durchführung dieses Grundsatzes in der Praxis bedeuten, daß viele Ausgebürgerte nunmehr, selbst gegen ihren eigenen Willen, automatisch wieder als Deutsche gelten und damit ihre Vermögenswerte in bestimmten ausländischen Staaten den Vorschriften über Feindvermögen unterworfen würden, wodurch den Betroffenen unter Umständen nachträglich noch größter Schaden erwachsen könnte. Unter allen Umständen aber mußte eine legale Grundlage geschaffen werden, um zu wissen, wer Deutscher ist und wer nicht. Als Ausweg blieb nur übrig, bei der Regelung es letztlich irgendwie auf den Willen der Beteiligten abzustellen.
Zunächst wollte man die Wiedereinbürgerung generell von einem entsprechenden Antrag abhängig machen. Ein derartiges Antragsrecht wurde auch für die Abkömmlinge von Ausgebürgerten vorgesehen, sollte aber, nach einem Vorschlag des Redaktionsausschusses, im übrigen nur dann gegeben sein, „sofern die Betreffenden eine andere Staatsangehörigkeit nicht besitzen oder diese vor der Einbürgerung aufgeben oder mit der Einbürgerung verlieren“. Diese Bedingung fiel jedoch, weil der Hauptausschuß darin eine unnötige Erschwerung der Rehabilitierung der Ausgebürgerten und eine unter Umständen nicht wünschenswerte Tendenz zum Staatsangehörigkeitsmonopol erblickte (2. Lesung, 39. Sitzung). Die nicht wegzuleugnende Unzulängichkeit aller Formulierungen dieser Art bestand darin, daß sie eine Bezugnahme auf den spezifischen Unrechtscharakter der nationalsozialistischen Ausbürgerungsmaßnahmen allzusehr vermissen ließen. Diese Bezugnahme fand sich dagegen, wenn auch in verdeckter und indirekter Form, in dem vom Hauptausschuß in erster Lesung am 7.12.1948 beschlossenen Zusatz:
insoweit ihnen die Staatsbürgerrechte nicht auf andere Weise zurückgegeben worden sind.
Der Zusatz wurde jedoch auf Veranlassung des Redaktionsausschusses in zweiter Lesung wieder gestrichen, weil mit der Rückgabe der Staatsbürgerrechte die Staatsangehörigkeit noch nicht wiedererlangt zu sein braucht.
Eine Lösung des Problems brachte dann, -Ausgangspunkt war ein entsprechender Antrag der Deutschen Partei -die dritte Lesung des Hauptausschusses (51. Sitzung), in der folgende, zwischen den nach dem 8. Mai 1945 in Deutschland ansässig Gewordenen sowie den übrigen Ausgebürgerten unterscheidende Formulierung gefunden wurde:
. . . und ihre Abkömmlinge gelten als nicht ausgebürgert, sofern sie seit dem 8. Mai 1945 ihren Wohnsitz in Deutschland genommen und nicht den entgegengesetzten Willen zum Ausdruck gebracht haben. Im übrigen sind sie auf Antrag wieder einzubürgern.
Das bedeutet, daß für die erstgenannte Kategorie die Ausbürgerungsakte grundsätzlich als rechtsungültig -es sei denn, daß die Betreffenden selbst sich für die Rechtsverbindlichkeit entscheiden -, für die zweite Kategorie hingegen als nur anfechtbare Staatsakte gelten sollen. Die endgültige Fassung erhielt Artikel 116 Absatz 2 in der vierten Lesung des Hauptausschusses (57. Sitzung); die auf Vorschlag des Redaktionsausschusses vorgenommene Umstellung der beiden Sätze bedeutete zwar eine gewisse „Akzentverschiebung“, jedoch keine eigentlich sachliche Aenderung.
Artikel 121 (Begriff „Mehrheit“ der Mitglieder des Bundestages und der Bundesversammlung):
Ausgangspunkt dieser Vorschrift war ein Vorschlag des Redaktionsausschusses (vom 18. 11. 1948):
Mehrheit der Mitglieder einer Körperschaft im Sinne dieses Grundgesetzes ist die Mehrheit der gesetzlichen Mitgliederzahl dieser Körperschaft.
Die vorgeschlagene Bestimmung wurde vom Organisationsausschuß (27. Sitzung) gestrichen, nachdem der Abg. Dr. Katz (SPD) betont hatte, der damit normierte Satz verstehe sich eigentllch von selbst; im übrigen sei es richtiger, ggf. bei den einzeinen einschlägigen Artikeln dieses Erfordernis besonders hervorzuheben. Der Redaktionsausschuß verblieb indes bei seiner Anregung und bemerkte dazu in einer erneuten Stellungnahme (18.12.1948), die Mehrheit der Mitgliederzahl sei mit der gesetzlichen Zahl der Mitglieder nicht identisch. Während die gesetzliche Zahl der Mitglieder auf Grund der einschlägigen gesetzlichen Bestimmung genau festliege, könne die tatsächliche Zahl der Mitglieder davon abweichen; sie sei vielfach geringer, z. B. in den Fällen, in denen Mitglieder verstorben seien, ihr Mandat niedergelegt hätten, ihre Wahl ungültig geworden sei oder sie ihr Mandat infolge Verlust der Wählbarkeit nachträglich verloren hätten und ein Ersatzmann noch nicht nachgerückt oder gewählt sei. Die tatsächliche Zahl der Mitglieder könne schwanken und müsse im Einzelfall festgestellt werden. Allerdings sei die Differenz zwischen gesetzlicher und tatsächlicher Zahl der Mitglieder meist nur gering, so daß es sich auch vertreten ließe, bei der Errechnung einer vorgeschriebenen qualifizierten Mehrheit auf die tatsächliche Zahl der Mitglieder abzustellen. Wolle man das aber nicht, sondern die gesetzliche Zahl als Ausgangspunkt nehmen, so empfehle es sich, die vorgeschlagene Legaldefinition in den Uebergangsbestimmungen festzulegen, um den Text des Grundgesetzes nicht an zahlreichen Stellen durch immer erneute Wiederholung des gleichen Ausdrucks zu belasten.
Von dieser Argumentation ließen sich der Organisationsausschuß (in seiner 30. Sitzung) und ebenso der Hauptausschuß überzeugen; die vorgeschlagene Bestimmung wurde in zweiter Lesung vom Hauptausschuß (39. Sitzung) dann einstimmig angenommen.
Für die dritte Lesung des Hauptausschusses schlug der Redaktionsausschuß eine sachlich treffendere und textlich bessere Fassung vor, und diese Formulierung wurde vom Hauptausschoß wie vom Plenum in den folgenden Lesungen ohne weitere Aenderung angenommen.
Einzelfragen:
Artikel 120 (Tragung der Aufwendung für Besatzungskosten usw. durch den Bund):
Der vom Hauptausschuß in zweiter und dritter Lesung im Abschnitt „Das Finanzwesen“ beschlossene damalige Art. 122 legte fest, daß die dem Bund zufließenden Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Bundes dienen sollten, darunter insbesondere (Ziffer 2) der Aufwendungen des Bundes für Besatzungskosten und sonstige äußere und innere Kriegsfolgelasten. Im Zusammenhang damit wurde vom Hauptausschuß in dritter Lesung (50. Sitzung) ein Uebergangsartikel folgenden Wortlauts geschaffen:
Die Besatzungskosten und die äußeren und inneren Kriegsfolgelasten hat grundsätzlich der Bund zu tragen. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz, in welchem die Begriffe Besatzungskosten und Kriegsfolgelasten zu bestimmen sind.
In den interfraktionellen Besprechungen vor der vierten Lesung im Hauptausschuß kündigte der Abg. Dr. Lehr (CDU) einen Antrag seiner Fraktion an, nachdem das die nähere Regelung treffende Bundesgesetz der Zustimmung des Bundesrates bedürfen solle. Der Abg. Dr. Greve (SPD) widersprach mit dem Hinweis, es sei selbstverständlich, daß der Bund die Besatzungskosten trage und daher nicht einzusehen sei, warum ein Gesetz, das die näheren Bestimmungen darüber treffe, nur mit Zustimmung des Bundesrates solle ergehen dürfen. Nach Auffassung seiner Fraktion solle die Zustimmung des Bundesrates nur in den im Gesetz bereits festgelegten Fällen gefordert werden. Von dem Abg. Zinn (SPD) wurde auf die Unklarheit hingewiesen, die entstehe, wenn man die Zustimmung des Bundesrates zu einem Gesetz mit dem Veto-Recht des Bundesrates verwechsele; wenn ein Gesetz der Zustimmung des Bundesrates bedürfe, dann komme das Gesetz überhaupt nicht zustande, falls der Bundesrat seine Zustimmung verweigere. Im vorliegenden Falle liege gerade das Veto-Recht viel eher im Sinne der Länder als das Zustimmungsrecht. Wenn sich die Länder benachteiligt fühlten, könne der Bundesrat sein Veto einlegen, das der Bundestag mit Zweidrittelmehrheit ausräumen müsse. Man müsse sich in solchen Fällen immer die Mechanik des Gesetzgebungsvorganges vor Augen halten.
Der Abg. Dr. Hoepker-Aschoff (FDP) gab zu bedenken, daß bei Gesetzen von solcher Tragweite immer eine Beratung des Bundesfinanzministers mit den Länderfinanzministern vorausgehen werde. Wenn dann ein Gesetzentwurf aus einer solchen gemeinsamen Beratung des Bundesfinanzministers mit den Finanzministern der Länder hervorgehe, sei es nicht erforderlich, auch noch die Zustimmung des Bundesrates vorzusehen. Der Abg. Dr. von Brentano (CDU) gab der Meinung Ausdruck, es handele sich nicht so sehr um eine grundsätzliche Frage als vielmehr um eine reine Zweckmäßigkeitsfrage. Der Abg. Dr. Greve (SPD) betonte nochmals, im Hinblick auf die Möglichkeit des Bundesrats, ein Veto einzulegen, bestünde keine Notwendigkeit dazu, die ausdrückliche Zustimmung des Bundesrates festzulegen. Von dem Abg. Dr. Menzel (SPD) wurde der dringende Wunsch geäußert, daß keine auf eine Erweiterung der Kompetenzen des Bundesrates abzielenden Anträge mehr gestellt würden; bei der Streichung des Kataloges in dem ursprünglichen Artikel 105 habe es sich um eine politisch wichtige Entscheidung gehandelt, von der man nicht mehr abgehen solle. Als der angekündigte Antrag in der vierten Lesung des Hauptausschusses (57. Sitzung) gestellt wurde, verfiel mit elf gegen zehn Stimmen der Ablehnung. Der Artikel wurde dann in der Fassung angenommen, wie sie der Redaktionsausschuß (unter dem 2.5.1949) vorgeschlagen hatte.
Artikel 119 (Besondere Ermächtigungen der Bundesregierung in Angelegenheiten der Flüchtlinge und Vertriebenen):
Diese Bestimmung wurde ausgelöst durch einen in zweiter Lesung des Hauptausschusses (45. Sitzung) gestellten gemeinsamen Antrag der Abgeordneten Dr. Mücke (SPD), Dr. Laforet (CSU) und Dr. Hoch (SPD):
Zur Regelung der Angelegenheiten der Flüchtlinge und Vertriebenen, insbesondere zu ihrer Verteilung und Zuweisung auf die Länder, kann bis zum Erlaß eines Bundesgesetzes die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates Vorschriften mit Getzeskraft erlassen. Sie kann dabei für besondere Fälle die Befugnis der Bundesregierung vorsehen, Einzelweisungen zu erteilen. Die Weisungen sind außer bei Gefahr im Verzuge an die obersten Landesbehörden zu richten.
Der Abg. Dr. Mücke (SPD) erklärte dazu erläuternd „Bisher gibt es -und hier auch nicht in allen Ländern -eine gesetzliche Regelung nur auf der Länderbasis. Diese Länder-Regelungen gehen ausschließlich von den Gegebenheiten der Länder und dazu von durchaus verschiedenartigen Auffassungen aus“. Er bezog sich weiter insbesondere auf die verschiedenartigen Feststellungen des Flüchtlingsbegriffes, die verschiedenartige Regelung auf dem Gebiet des Versorgungswesens, sowie die sehr unterschiedlich gehandhabte Behandlung der Flüchtlings-Organisationen und des Zuzugwesens; vor allem aber sei durch das Fehlen einer gesamtdeutschen Instanz die dringend erforderliche gerechte Verteilung der Flüchtlinge auf die einzelnen Länder bisher unmöglich gemacht worden. Es müsse möglichst sofort -dabei könne nicht bis zum Zustandekornmen eines Bundesgesetzes gewartet werden -mit Maßnahmen begonnen werden zum Zwecke der Auflockerung der Zusammenballung von Menschenmassen. Auch der Abg. Dr. Laforet (CSU) wies darauf hin, daß bis zum Inkrafttreten des Gesetzes viele Monate vergehen könnten: „Wir schlagen deshalb den ganz besonderen Weg vor, der Bundesregierung für die Zeit bis zur Erlassung eines Bundesgesetzes die Ermächtigung zu Rechtsvorschriften mit Gesetzeskraft zu geben. Es ist ein Ermächtigungsgesetz, wenn Sie es so wollen, aber ein durch den Gegenstand notwendiges Ermächtigungsgesetz ganz besonderer Art“. Der Abg. Dr. Seebohm (DP) bemängelte, daß für den Erlaß des im Interesse der Flüchtlinge und Vertriebenen dringend erforderlichen Gesetzes kein Termin gesetzt sei, sodaß durch die hier vorgesehene Ermächtigung der Bundestag auf lange Zeit hinaus ausgeschaltet werden könne. Deshalb sei es richtig, durch eine Termin-Festlegung die Bundesregierung zur möglichst schnellen Vorlage eines derartigen Gesetzes zu veranlassen. Außerdem war er der Ansicht, der Antrag enthalte implicite auch die Anweisung an die Bundesregierung, für die Vertriebenen und Flüchtlingsangelegenheiten ein besonderes Amt oder Ministerium einzurichten.
In der Abstimmung wurde der Antrag des Abg. Dr. Seebohm (DP):
Diese Ermächtigung endet spätestens zwei Jahre nach Zusammentritt des Bundestages
mit zwölf gegen sieben Stimmen abgelehnt, desgleichen gegen die Stimme des Abg. Renner (KPD) dessen Antrag auf Beifügung eines Satzes:
Die Bundesregierung hat nachträglich die Genehmigung des Bundestages einzuholen.
Der Artikel wurde dann vom Hauptausschuß gemäß dem eingangs erwähnten Antrag und mit einigen redaktionellen Aenderungen angenommen.
Einige weitere, vom Redaktionsausschuß vorgeschlagene Verbesserungen in der juristischen Formulierung wurden vom Hauptausschuß in seiner dritten Lesung (51. Sitzung) akzeptiert und damit dieser Vorschrift die endgültige Fassung gegeben.
Zu der Rechtsfigur „gesetzesvertretende Verordnung“ ist bereits bei der Behandlung des Artikes 129 Stellung genommen worden. Es handelt sich hier im Falle des Artikels 119 um den exceptionellen Fall des Erlasses von gesetzesvertretenden Verordnungen (ein zweiter derartiger Fall findet sich in Artikel 127: Inkraftsetzung gewisser Rechtsvorschriften im Bereich der französischen Zone). Diese beiden Fälle sind außerdem zusammen mit dem Fall des Artikels 132 Absatz 4 Fälle eines Verordnungsrechts kraft verfassungsrechtlicher Ermächtigung. Aus diesen Gründen wurde wohl auch in erster Linie jeweils die Zustimmung des Bundesrates für erforderlich gehalten. Gemäß Artikel 80 Absatz 1 Satz 3 muß in den Verordnungen jeweils diese grundgesetzliche Bestimmung als Rechtsgrundlage angegeben werden.
Von dem Begriff „Einzelweisungen“ ist bereits bei der Erörterung des Artikels 128 die Rede gewesen. Zu erwähnen bleibt noch, daß verabsäumt wurde, die Formulierung „bei Gefahr im Verzuge“ der in der vierten Lesung des Hauptausschusses für den Artikel 84 Absatz 5 beschlossenen Neufassung, insbesondere der Wendung „sofern sie (die Bundesregierung) den Fall für dringlich erachtet“ anzupassen. Es handelt sich hier um ein redaktionelles Versehen, in der Sache selbst sollte jedenfalls die verschiedenartige Fassung keine Unterschiedlichkeit zum Ausdruck bringen; d. h. es sollte auch nicht etwa für diesen Spezialfall insoweit ggf. eine Kognition des Bundesverfassungsgerichts ermöglicht werden.
Artikel 118 (Südwest-Staat):
Artikel 29 des Grundgesetzes sieht die Neugliederung des Bundesgebietes durch Bundesgesetz vor. In Gebietsteilen, die bei der Neubildung der Länder nach dem 8. Mai 1945 ohne Volksabstimmung ihre Landeszugehörigkeit geändert haben, kann auch eine Aenderung der früher getroffenen Entscheidung durch Volksbegehren gefordert werden. Bei Zustandekommen eines derartigen Begehrens hat die Bundesregierung in den Neugliederungs-Gesetzentwurf eine Bestimmung über die Landeszugehörigkeit des betreffenden Gebietsteiles aufzunehmen. Weiterhin ist in jedem derartigen Falle in dem betreffenden Gebiet ein Volksentscheid durchzuführen (sonst nur nach Annahme des Neugliederungsgesetzes, und zwar jeweils in einem Gebiet, dessen Landeszugehörigkeit geändert werden soll, nur der dieses Gebiet betreffende Gesetzesteil). Fällt der Volksentscheid in dem jeweiligen Gebiet positiv aus, so ist die Neugliederung damit zustande gekommen. Diese -demokratischen Gesichtspunkten in weitest möglichem Maße Rechnung tragende -Regelung ist nach dem Vorschlag des Redaktionsausschusses erst in der vierten Lesung des Hauptausschusses (57. Sitz.) beschlossen worden. Die frühere Fassung hatte dagegen vorgesehen (Absatz 4 Satz 2), daß das Gesetz, wenn die Bevölkerung nicht in allen beteiligten Gebieten zustimme, beim Bundestag erneut einzubringen und nach erneuter Verabschiedung als Ganzes im gesamten Bundesgebiet einer erneuten Volksabstimmung zu unterbreiten sei.
Insbesondere die zuletzt genannte Bestimmung erschien nicht als gerechte und geeignete Lösung des viel diskutierten Problems des sogen. Südwest-Staates. Deshalb war für die vierte Lesung des Hauptausschusses ein Antrag der Abg. Hilbert (CDU), Kühn (CDU), Dr. Laforet (CSU), Schloer (CSU) und Dr. de Chapeaurouge (CDU) gestellt worden, in die Uebergangsbestimmungen einen Artikel folgenden Inhalts zu bringen:
1. Gebietsteile im Sinne des Artikels 25 Absatz 4 (jetzt Artikel 29) sind bei einer Neugliederung der Länder Baden, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern die Länder Baden, Württemberg und die Hohenzollernschen Lande in ihrem Gebietsbestand vom 30. Januar 1933. Die Volksabstimmung in diesen Gebieten entscheidet endgültig über die Annahme des Bundesgesetzes über die Neugliederung; Artikel 25 Absatz 4 Satz 2 findet keine Anwendung.
2. Sieht das Bundesgesetz über die Neugliederung der Länder Baden, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern nicht die Wiederherstellung der früheren Länder Baden und Württemberg vor, so sind bei seiner Ablehnung diese Länder in ihrem Gebietsbestand vom 30. Januar 1933 wieder hergestellt; die Hohenzollernschen Lande haben durch Volksabstimmung zu bestimmen, ob sie sich Baden oder Württemberg anschließen wollen. Bei dieser Volksabstimmung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
Die besondere Dringlichkeit des Problems Südweststaat zeitigte in der gleichen Sitzung des Hauptausschusses noch einen weiteren Antrag der Abgeordneten Dr. Eberhard (SPD), Maier (SPD), Zimmermann (SPD) und Dr. Heuß (FDP):
Die Neugliederung im Gebiet der Länder Baden, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern kann in Abweichung von den Bestimmungen der beteiligten Länder erfolgen. Soweit eine Vereinbarung nicht zustande kommt, trifft ein Bundesgesetz die erforderlichen Bestimmungen. In jedem Fall ist baldmöglichst eine Volksabstimmung vorzusehen. Die Neugliederung tritt mit Erlaß eines Bundesgesetzes in Kraft.
Der Abg. Dr. Eberhard (SPD) bemerkte dazu erläuternd, ursprüngIich habe man angenommen, die Militärregierungen würden die Möglichkeit geben, Volksabstimmungen im Raum des künftigen Südweststaates entsprechend dem Dokument Nr. II vorzunehmen, indes sei diese Möglichkeit nicht verwirklicht worden. Er fuhr fort: „Die Militärregierungen haben jetzt erklärt, sofort nach Bildung der Bundesregierung werde sich die Möglichkeit ergeben. Der Antrag soll die Möglichkeit schaffen, diese Chance auszuschöpfen. Er stellt nicht fest, daß der Südwest-Staat so oder so gebildet werden soll, er gibt nur die Chance, vorweg, d. h. vor der globalen Regelung, die der Artikel 25 ermöglicht, eine Regelung im Südwesten Deutschlands vorzunehmen, entweder auf Grund einer Vereinbarung der beteiligten Länder oder auf Grund eines Bundesgesetzes, in jedem Fall unter Volksabstimmung in den beteiligten Gebieten“. Der Abg. Dr. von Brentano (CDU) wies auf eine Unklarheit in dem Antrage hin und warf die Frage auf, welche Bedeutung dem auf die Volksabstimmung bezüglichen Satz zukommen solle. Darauf wurde von dem Abg. Dr. Eberhard (SPD) erwidert, eine Volksabstimmung solle stattfinden, sowohl im Falle der Vereinbarung der beteiligten Länder, die im Grunde beinahe schon vorhanden gewesen sei, als auch in dem Falle, daß ein Bundesgesetz dieses Sonderverfahren in Gang bringe. Der Abg. Dr. von Brentano (CDU) stellte dann fest, daß damit die Entscheidung von der Volksabstimmung abhängig sei.
Auf Antrag des Abg. Zinn (SPD) wurde die Angelegenheit zurückgestellt, und es fanden weitere Besprechungen zwischen den verschiedenen Antragstellern statt. Das Ergebnis war die Vorlage eines neuen gemeinsamen Antrages der Abgeordneten Hilbert (CDU), Kühn (CDU), Kaufmann (CDU), Zimmermann (SPD), Dr. Eberhard (SPD) und Dr. Heuß (FDP). Dadurch erhielt der Artikel seine jetzige Fassung.
Die Militärregierungen hatten mit Schreiben vom 12. Mai 1949 mitgeteilt, daß, „die in den genannten Artikeln (29, 118) festgelegten Befugnisse nicht ausgeübt und die Grenzen aller Länder mit Ausnahme von Württemberg-Baden und Hohenzollern bis zum Zeitpunkte des Friedensvertrages, so wie sie jetzt festgelegt sind, bestehen bleiben“ sollten. Die in dem Schreiben erwähnte Ausnahme erstreckt sich selbstverständlich auch auf das offenbar versehentlich nicht mit aufgeführte Land Baden.
Hervorzuheben ist, da, falls die Neugliederung durch Vereinbarung der beteiligten Länder erfolgt, diese Vereinbarung von bundesverfassungswegen, entgegen den ursprünglichen Plänen, einer Volksabstimmung nicht unterliegt. Möglich ist jedoch, daß das Zustandekommen einer solchen staatsvertraglichen Vereinbarung von dem Ausfall einer in einem der beteiligten Länder durchzuführenden Volksabstimmung bzw. von Volksabstimmungen in allen oder in mehreren dieser Länder -jeweils auf Grund entsprechender landesverfassungsrechtlicher Bestimmungen -abhängig gemacht wird. Diese Abstimmung(en) könnte(n) ggf. auch in der Form der Beantwortung einer Alternativfragestellung vor sich gehen; d. h. es könnte, neben der in der Vereinbarung vorgesehenen, auch noch eine andere Lösung dem betreffenden Landesvolk (Landesvölkern) zur Entscheidung vorgelegt werden. Denkbar wäre auch -bei Zulässigkeit auf Grund der jeweiligen Landesverfassungen -, daß eine derartige Volksbefragung als erster Akt stattfände, und daß dann, je nach dem Ergebnis der Befragung, die Vereinbarung getroffen würde.
Das für den Fall, daß eine Vereinbarung -ggf. im Hinblick auf den Ausfall einer solchen Volksbefragung -nicht zustandekommt, vorgesehene Bundesgesetz braucht seinerseits nicht etwa -ebensowenig wie eine staatsvertragliche Vereinbarung -die Neugliederung in der Gestalt der Schaffung eines „Südwest-Staates“ vorzusehen. Inhalt des Gesetzes könnte z. B. auch die Wiederherstellung der früheren Länder Baden und Württemberg sein, eine Möglichkeit, von der inbesondere der Antrag Kühn-Hilbert ausdrücklich ausgegangen war. Gleichgültig aber, welche Regelung aber in dem Gesetz vorgesehen würde, in jedem Falle wäre das Schicksal des Gesetzes abhängig von dem Ausgang der für diesen Fall durch das Grundgesetz zwingend vorgeschriebenen Volksbefragung. Diese Befragung hat den Charakter eines Volksentscheids. Es kommt, obwohl nicht ausdrücklich im Wortlaut der Verfassungsbestimmung zum Ausdruck gebracht, lediglich eine Volksbefragung, die auf den Raum des Südwestgebietes begrenzt ist, in Frage.
Das Grundgesetz kennt den Volksentscheid in Gestalt eines Entscheides des gesamten Bundesvolkes als generelle verfassungsrechtliche Institution nicht, weder in obligatorischer noch in fakultativer Form, mag man darin auch einen prinzipiellen, einen Strukturfehler erblicken und die Ablehnung der dahin zielenden Anträge bedauern. In dem Sonderfall des Art. 29 aber ist überdies ein Gesamtvolksentscheid nur eventualiter, nämlich nur für den Fall der Ablehnung des dort behandelten Neugliederungsgesetzes in einem Gebietsteil vorgesehen, und nur über den abgelehnten Gesetzesteil. Zunächst jedenfalls entscheidet die betreffende Gebietsbevölkerung, deren Entscheidung im Falle der Annahme des Gesetzes auch endgültig ist. Erst recht aber soll die Neugliederung des Südwestens nach Sinn und Zweck des Artikels 118 eigene Angelegenheit der Südwest-Bevölkerung sein. Als unvereinbar damit wäre es anzusehen, wenn dieses Südwestgebiets-Spezialgesetz im Falle seiner Ablehnung durch die Südwest-Bevölkerung nochmals beim Bundestag eingebracht werden könnte und dann das Gesamtvolk über sein endgültiges Zustandekommen entscheiden sollte; erst recht aber, wenn das Gesetz von vornherein dem Volk im gesamten Bundesgebiet zur Entscheidung unterbreitet würde. Eine solche Mehrheitsentscheidung kann gerade in Gebietsfragen, noch dazu, wenn der gebietsfremde Teil des Volkes an den betreffenden Problemen vielleicht überhaupt keinen inneren Anteil nimmt, sehr leicht in besonderem Maße als ausgesprochene Zwangsmaßnahme empfunden werden. Artikel 29 kennt sie deshalb auch nur als ultima ratio.
Zu entscheiden haben wird der Bundesgesetzgeber dagegen die Frage, ob er, entsprechend dem ursprünglichen Antrag Kühn-Hilbert, das Volk in jedem einzelnen der drei Länder als drei getrennte, jeweils für sich selbständig entscheidende Größen anerkennen will, sodaß z. B., falls die Bildung eines Südwest-Gesamtstaates vorgesehen wäre, dieser abgelehnt wäre, wenn z. B. im Lande Baden die Mehrheit sich dagegen ausspricht, oder ob eine andere Regelung zweckmäßiger erscheint.
Wenn das zur Abstimmung gebrachte Gesetz dabei die Zustimmung der erforderlichen Mehrheit -ob die -stimmberechtigte -Gesamtbevölkerung des Südwestens als Abstimmungseinheit anzusehen ist oder nicht, muß, wie erwähnt, vom Gesetzgeber entschieden werden -nicht findet, bleibt immer noch der Weg, auch für das Südwest-Problem die durch Artikel 29 gegebenen Möglichkeiten auszuschöpfen, d. h. es in den Rahmen des allgemeinen Neugliederungsgesetzes mit einzubeziehen. Dann allerdings würde unter Umständen das Volk im gesamten Bundesgebiet das letzte Wort zu sprechen haben.
Artikel 137 Absatz 1 (Möglichkeit gesetzlicher Beschränkung der Wählbarkeit von Beamten usw.):
Diese Vorschrift ist erst in der dritten Lesung des Plenums, vor allem in Folge der wiederholten alliierten Stellungnahmen, auf Grund eines Antrages der Abg. Dr. Menzel (SPD) und Dr. Strauß (CDU) in das Grundgesetz aufgenommen worden.
Auf Grund der Bestimmungen des Wahlgesetzes zum ersten Bundestag vom 15. Juni 1949 müssen die Beamten und Richter des Bundes selbst sowie die Beamten einer bundesunmittelbaren Körperschaft vor der Annahme der Wahl in den Bundestag ihre Versetzung in den Wartestand beantragen. Das gilt allerdings nicht für die öffentlichen Dienstkräfte der Länder, da diese nicht bundesunmittelbare Körperschaften sind. In viel weiter gehendem Umfang wird der Grundsatz der Gewaltenteilung verwirklicht durch das von der Militärregierung erlassene Gesetz Nr. 20, nach dem Richter, Beamte und Angestellte des öffentlichen Dienstes mit Annahme der Wahl zum Bundestag aus dem öffentlichen Dienst ausscheiden. Ausgenommen davon sind lediglich Personen, die ein Ehrenamt bekleiden, Personen, die keine feste Besoldung beziehen, Hochschullehrer und Geistliche.
Es fragt sich, ob von dieser Bestimmung auch Landesminister, die in den Bundestag gewählt sind, erfaßt werden. Eine weitverbreitete Auffassung geht dahin: „Der Sinn der Vorschrift ist ganz offensichtlich, eine Ausführungsbestimmung zu dem im Grundgesetz verankerten Grundsatz der Trennung der Gewalten zu geben. Und da kann es nur als äußerster Formalismus bezeichnet werden, wenn man die Landesminister von dieser Regelung ausnehmen wollte, da sie im Sinne der Beamtengesetze nicht als ,Beamte‘ gelten, sondern in einem besonderen öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis stehen. Sie sind vielmehr die spezifischen Träger der Exekutive und gehören daher als allererste zu dem Kreise, der hier bezeichneten Dienstkräfte“ (vgl. Die Neue Zeitung vom 20. 8.1949).
Diese Argumentation ist allerdings nicht unbedingt durchschlagskräftig, da die Institution des Bundesrates (Legislativorgan, bestehend aus den Spitzen der Landesexekutiven) an sich schon ohne Zweifel eine gewisse Durchbrechung des Gewaltentrennungsprinzips darstellt. Aus der Gestaltung des Bundesrates ergibt sich aber andererseits unzweideutig, daß eine gleichzeitige Mitgliedschaft in einer Landesregierung und im Bundestag unmöglich ist. In dieser Hinsicht erscheinen durchaus überzeugend die Ausführungen, mit denen soeben Minister Dr. Süsterhenn zu den Problemen Stellung genommen hat: „Da der Bundesrat nach den Bestimmungen des Grundgesetzes aus Mitgliedern der Landesregierungen besteht, die nicht nach eigenem freien Ermessen, sondern nach Instruktionen ihrer Landesregierungen im Bundesrat abstimmen, muß logischerweise der Grundsatz der Inkompatibilität nicht nur für ausdrücklich von den Landesregierungen bestellte Bundesratsmitglieder, sondern auch für diejenigen gelten, die als Mitglieder der Landesregierungen an der Instruktion der Bundesratsbevollmächtigten mitwirken. Daraus würde sich also ergeben, daß die gleichzeitige Mitgliedschaft im Bundestag und in einer Landesregierung zwar nicht nach den positiven Bestimmungen des Grundgesetzes ausdrücklich verboten ist, jedoch der staatsrechtlichen Logik und der politischen Struktur des Grundgesetzes widerspricht“ (Rheinischer Merkur vom 27. 8. 1949).
Artikel 143 (Hochverräterische Handlungen):
Die Vorschriften des St.G.B. über den Hoch- und Landesverrat waren durch Gesetz vom 24.4.1934 neugefaßt worden. Dieses Gesetz wurde durch das Kontrollratsgesetz Nr. 1 aufgehoben. Um die dadurch entstandene Lücke auszufüllen, wollte ein Antrag des Abg. Dr. Becker (FDP) vom 22.10.1948 in sehr detalllierter Form neue entsprechende Bestimmungen geschaffen wissen.
Auch der Redaktionsausschuß hielt es für notwendig, dem Bund und seinen Organen den nötigen Rechtsschutz zu gewährleisten, und zwar bereits auch während der Uebergangszeit. Er machte deshalb (unter dem 24.11.1948) einen Vorschlag, der unter Mitwirkung des Strafrechtlers Prof Dr. von Weber ausgearbeitet worden war, und der zwei verschiedene Varianten enthielt. Die erste Variante sah die Wiederinkraftsetzung der §§ 80 bis 89 des St.G.B. in der Fassung vom 15.5.1871 vor; die zweite Variante legte die Vorschriften des Entwurfes eines allgemeinen Deutschen Strafgesetzbuches voin 15.4.1927 zugrunde und wollte zu diesem Zweck die §§ 86 bis 95 Absatz 1 Ziffer 1), 95 Absatz 2 bzw., bezüglich der Strafbemessung, die §§ 69 bis 77 des vorgenannten Entwurfes in Kraft setzen. Der Landesverrat sollte also mit einbezogen werden.
Im Organisationsausschuß (27. Sitzung) kam insbesondere die hochpolitische Bedeutung der Angelegenheit zur Sprache. Vor allem von den Abgeordneten Dr. Katz und Zimmermann (SPD) wurde darauf hingewiesen, daß der Fall des Hochverrates in diesem Zusammenhang anders zu beurteilen sei als der des Landesverrates, bei dem die nun einmal gegebene Tatsache der Besetzung Deutschlands und der sich daraus ergebenden Frage des Verhältnisses zu den Besatzungsmächten eine außerordentlich delikate Angelegenheit sei. Nach Ansicht des Abg. Dr. Fecht (CDU) gehörten die Bestimmungen überhaupt nicht in die Verfassung, sondern in das Strafrecht. Der Ausschuß neigte zu der Ansicht, es werde zweckmäßig sein, die Schließung der Lücke einer Neufassung des Strafgesetzbuches zu überlassen. Er beschloß, die Beschlußfassung über diese Materie der zweiten Lesung des Hauptausschusses vorzubehalten.
Der Redaktionsausschuß wiederholte (unter dem 18.12.1948) seine bereits gemachte Anregung und fügte einen weiteren Vorschlag betreffend die Zuständigkeit der Gerichte zur Aburteilung einschlägiger Straftaten hinzu.
Der Organisationsausschuß beschäftigte sich mit diesem Fragenkomplex nochmals in seiner 32. Sitzung. Der Abg. Dr. Katz (SPD) wies darauf hin, die Wiederinkraftsetzung von Bestimmungen zum Schutze der obersten Bundesorgane sei notwendig. Es erscheine aber zweckmäßig, sich hierbei zunächst auf die Bestimmungen über Hochverrat zu beschränken und die Schaffung von Bestimmungen über Landesverrat dem Bundestag zu überlassen. Auch der Abg. Dr. Lehr (CDU) sprach sich dafür aus, in das Grundgesetz nur Vorschriften über Hochverrat aufzunehmen. Nachdem der Abg. Zinn (SPD) darauf hingewiesen hatte, es sei am zweckmäßigsten, auf die Bestimmungen des Entwurfes von 1927 zurückzugreifen, die einen Niederschlag der neuzeitlichen Erfahrungen enthielten, pflichteten insbesondere die Abgeordneten Dr. Katz (SPD) und Walter (CDU) diesem Vorschlag grundsätzlich bei, wünschten jedoch nach Möglichkeit eine textlich kürzere Fassung. Der Redaktionsausschu8 wurde gebeten, für die dritte Lesung des Hauptausschusses -in der zweiten Lesung war die Angelegenheit ebenso wie in der ersten Lesung vom Hauptausschuß zurückgestellt worden -eine Neuformulierung zu versuchen.
Dieser Anregung kam der Redaktionsausschuß nach; sein neuer, nur den „Hochverrat“ berücksichtigender Vorschlag (vom 25.1.1949) wurde vom Fünfer-Ausschuß und vom Hauptausschuß in dritter Lesung (61. Sitzung) gutgeheißen; die Vorschrift hat später -in der vierten Lesung des Hauptausschusses (57. Sitzung) noch eine kleine textliche Verbesserung erfahren, ist aber im übrigen bis zur Schlußabstimmung unverändert geblieben.
Artikel 138 (Eventuelle Aenderungen des süddeutschen Notariatwesens):
Der Hauptausschuß beschloß in zweiter Lesung (40. Sitzung) die Einbeziehung des Notariats in den Katalog der konkurrierenden Gesetzgebung. Gleichzeitig wurde, entsprechend einem auf einem CDU-Antrag beruhenden Beschluß des Organisationsausschusses (31. Sitzung), mit Rücksicht auf die besondere Eigenart des süddeutschen Notariatwesens die jetzige Uebergangsbestimmung beschlossen.
In der vierten Lesung (57. Sitzung) nahm der Hauptausschuß auf Vorschlag des Redaktionsausschusses lediglich noch eine kleine textliche Verbesserung vor: Einfügung des Wortes „dieser“ vor das Wort „Länderregierungen“.
Falls -dies kann nur im formellen Gesetzgebungsverfahren geschehen -eine entsprechende Aenderung erfolgt, wird bei der Veröffent!ichung des Gesetzes die Tatsache des Vorliegens der Zustimmungserklärungen der Länderregierungen ausdrücklich zu erwähnen sein.
Schaffung der Voraussetzungen für das Effektivwerden der ersten Bundesorgane:
Artikel 136 Absatz 1 (Erstmaliger Zusammentritt des Bundesrates):
Der Organisationsausschuß hatte in seiner 18. Sitzung einen Vorschlag des Abg. Dr. Katz (SPD) angenommen:
Die Volkskammer und die Länderkammer sind spätestens dreißig Tage nach ihrer Wahl vom Präsidium des Parlamentarischen Rates nach der Stadt X einzuberufen.
Dazu wurde in einer gutachtlichen Stellungnahme des Rechnungshofes darauf hingewiesen, die Fassung lasse nicht klar erkennen, ob der dreißigste Tag nach der Wahl der späteste Tag der Einberufung oder des Zusammentritts sein solle. Wahrscheinlich dürfte das letztere gemeint sein. Im übrigen empfehle es sich, den Tag des Zusammentritts im Grundgesetz selbst festzulegen und dem Präsidium des Parlamentarischen Rates die Möglichkeit zu eröffnen, Bundestag und Länderkammer zu einem früheren Tage einzuberufen.
Der Redaktionsausschuß war (Vorschlag vom 18.11.1948) der Ansicht, die Einberufung des Bundestages werde zweckmäßiger im Wahlgesetz geregelt; eine besondere Regelung der Einberufung des Bundesrates sei, entsprechend dem Vorbild der Weimarer Verfassung, nicht -weder im Grundgesetz noch an anderer Stelle -erforderlich. Vor allem mit Rücksicht auf die dem Bundesrat im Grundgesetz schließlich gegebene Gestalt, die von der Gestaltung des Weimarer Reichsrats in vielen Punkten abweicht, erwies sich jedoch eine ausdrückliche Regelung als unumgänglich. Es mußte insbesondere der Möglichkeit vorgebeugt werden, daß der Bundesrat sich ggf. noch vor dem Zusammentritt des Bundestages als Bundesorgan konstituieren würde. Dieser Notwendigkeit trug ein in der letzten Lesung des Plenums gestellter Antrag des Abg. Dr. Schmid (SPD) Rechnung. Mit seiner Annahme war die Vorschrift des Absatz 1 geschaffen.
Artikel 156 Absatz 2 (Vorläufige Ausübung der Funktionen des ersten Bundespräsidenten durch den Präsidenten des Bundesrates):
Der Herrenchiemseer Entwurf sah in Artikel 143 Absatz 1 folgende Bestimmung vor:
Bis zur Herstellung einer angemessenen völkerrechtlichen Handlungsfreiheit des Bundes und bis zur Klärung seiner Stellung zu den ostdeutschen Ländern werden die Befugnisse des Bundespräsidenten von dem Präsidenten des Bundesrates wahrgenommen. Dieser kann insolange weder Vertreter seines Landes im Bundesrat noch Mitglied der Bundes- oder einer Landesregierung sein.
Demgegenüber machte der Redaktionsausschuß den Vorschlag (18.11.1948):
Bis zur Wahl des ersten Bundespräsidenten werden dessen Befugnisse von dem Präsidenten des Bundestages ausgeübt. Das Recht zur Auflösung des Bundestages steht ihm nicht zu.
Dem Organisationsausschuß lag in seiner 22. Sitzung ein SPD-Antrag vor, der u. a. besagte:
Die Funktionen des Bundespräsidenten werden bis auf weiteres von dem Präsidenten des Bundestages ausgeübt. In Erfüllung dieser Funktion bleibt der jeweilige Präsident des Bundestages bis zum Amtsantritt seines Nachfolgers im Amt. Der Präsident des Bundestags wird in seiner Funktion als einstweiliger Bundespräsident im Falle seiner Verhinderung durch den ersten Vizepräsidenten des Bundestages vertreten…..Ein einfaches Bundesgesetz bestimmt den Zeitpunkt, an dem diese vorläufige Regelung endet…..
Zur Begründung bemerkte der Abg. Dr. Katz (SPD), die SPD stimme grundsätzlich der Einrichtung der Präsidentschaft als Funktion zu, wolle sie aber vorerst hinausschieben, vor allem mit Rücksicht auf das Verhältnis des Bundespräsidenten zu den Besatzungsmächten. Während die Abg. Frau Wessel (Z) dem SPD-Antrag zustimmte, hielt der Abg. Kaufmann (CDU) den Vorschlag nicht für geeignet, das damit erstrebte Ziel zu erreichen. Auch erhoben sich starke Bedenken vom Standpunkt der Gewaltentrennung aus. Von dem Abg. Walter (CDU) wurde überdies geltend gemacht, eine Vereinigung beider Aemter sei auch praktisch nicht gut möglich; außerdem könne der Bundespräsident auch jetzt schon gegenüber den Besatzungsmächten erhebliche Bedeutung gewinnen. Von dem Abg. Dr. Schwalber (CSU) wurde hervorgehoben, daß die Besatzungsmächte sich an die Bundesregierung und nicht an den Bundespräsidenten wenden würden. Außerdem meinte der Abg. Dr. Fecht (CDU), eine etwaige Brüskierung des Bundestagspräsidenten sei ebensowenig angenehm wie eine solche des Bundespräsidenten. Bei der Abstimmung wurde der Artikel mit sieben gegen fünf Stimmen in folgender, von dem Abg. Zinn (SPD) vorgeschlagenen Fassung angenommen:
Der Zeitpunkt der Wahl des ersten Bundespräsidenten wird durch Bundesgesetz bestimmt. Bis zum Amtsantritt des ersten Bundespräsidenten werden seine Befugnisse durch den Präsidenten des Bundestages ausgeübt. Im Falle seiner Verhinderung wird er durch den ersten Vizepräsidenten des Bundestages vertreten. In Erfüllung dieser Aufgaben bleibt der Präsident und der Vizepräsident des Bundestages bis zur Wahl ihrer Nachfolger im Amt.
Vom Hauptausschuß wurde die vorgeschlagene Bestimmung in erster Lesung (10. Sitzung) eingehend diskutiert. Von dem Abg. Wa’ter (CDU) wurde darauf hingewiesen, die angeführten Gründe könnten ebenso gut für eine provisorische Besetzung des Kanzleramtes geltend gemacht werden. Der Vorschlag führe zu einer untragbaren Vermischung der Legislative und Exekutive. In gewissen Fällen würde der Bundestagspräsident als Platzhalter des Bundespräsidenten den Bundestag aufzulösen haben. Von dem Abg. Dr. Seebohm (DP) wurde insbesondere betont, die beide Aemter erforderten ganz verschiedene Charaktere, und der Bundestagspräsident müsse dem politischen Tageskampf näherstehen, als mit der Würde des Bundespräsidenten vereinbar sei. Der Abg. Dr. von Brentano (CDU) erblickte in dem vorgeschlagenen Artikel den Ansatzpunkt einer bedenklichen staatsrechtlichen Fehlentwicklung. Der Parlamentspräsident sei kein Organ des Staates, sondern des Parlaments. Wenn der Parlamentspräsident in Frankfurt die vom Wirtschaftsrat beschlossenen Gesetze ausfertige, so werde dies von allen als eine staatsrechtliche Anomalie empfunden. Er sehe die Fehlentwicklung vor allem darin, daß sich bei Annahme des Art. ein den „Volksdemokratien“ ähnliches System ergebe, wo man aus ganz anderen Gründen den Parlamentspräsidenten zum „Ersten Mann“ im Staat gemacht habe. Von den Abg. Dr. Heuß (FDP) und Dr. Katz (SPD) wurde auf den besonderen Charakter der Vorschrift als Uebergangsbestimmung hingewiesen, von letzterem dazu noch betont, von den drei klassischen Funktionen des Staatspräsidenten entfielen zwei (Oberbefehl über die Wehrmacht und Vertretung in außenpolitischen Angelegenheiten), und die dritte Funktion (pouvoir neutre) könne vor übergehend vorn Bundestagspräsidenten wahrgenommen werden. Der Abg. Dr. Pfeiffer (CSU) brachte noch zum Ausdruck, die Aufgaben des Bundestagspräsidenten würden gerade zu Anfang so umfangreich sein, daß sie überhaupt nicht von derselben Person wahrgenommen werden könnten. Schließlich lehnte der Hauptausschuß mit zehn gegen acht Stimmen den Vorschlag ab.
Darauf schlug der Redaktionsausschuß (unter dem 18.12.1948) die nunmehrige Bestimmung vor: Ausübung der Bundespräsidentenfunktionen bis zur Wahl des ersten Bundespräsidenten durch den Präsidenten des Bundesrates, jedoch ohne Recht der Bundestagsauflösung. Dieser Vorschlag fand die Zustimmung des Organisationsausschusses (31. Sitzung) sowie des Hauptausschusses (in seiner 40. und den späteren Sitzungen).
In den interfraktionellen Besprechungen vor der vierten Lesung des Hauptausschusses erklärte der Abg. Zinn (SPD) es für überflüssig, noch einen besonderen Uebergangsartikel für die Wahl des ersten Bundespräsidenten zu schaffen, weil die Bundesversammlung den Bundespräsidenten sofort wählen könne und solle. Präsident Dr. Adenauer wies darauf hin, daß die Bestimmung dem Bundesratspräsidenten keine Möglichkeit geben dürfe, den Bundestag einzuberufen. Die Einberufung des Bundestages sei ein Faktum von denkbar größter Bedeutung. Während der Abg. Dr. Lehr (CDU) keine Bedenken dagegen hatte, daß zunächst der Präsident des Bundesrates wichtige Funktionen, wie z. B. die Einführung des neugewählten Bundespräsidenten vornehme, sah der Abg. Dr. von Mangoldt (CDU) keine glückliche Lösung darin, wenn der neue Bundespräsident durch den stellvertretenden Bundespräsidenten eingeführt werde. Der Abg. Kaufmann (CDU) war der Meinung, es werde sich ein Weg für diese Einführung finden lassen. Da im Zeitpunkt der Wahl des Bundespräsidenten der Bundestag und die Bundesversammlung bereits verhanden sei, werde diese Aufgabe voraussichtlich dem Vorsitzenden der Bundesversammlung zufallen.
In seiner vierten Lesung (57. Sitzung) lehnte der Hauptausschuß mit zehn gegen neun Stimmen den Streichungsantrag des Abg. Zinn (SPD) ab, desgleichen das Plenum in seiner zweiten Lesung.
Artikel 137 Absatz 2 (Besonderes Wahlgesetz für die Wahl des ersten Bundestages, der ersten Bundesversammlung und des ersten Bundespäsidenten):
Der Redaktionsausschuß regte (unter dem 18.11.1948) an, die Einberufung des ersten Bundestages überhaupt nicht im Grundgesetz zu erwähnen, sondern die Regelung einfach einem Wahlgesetz zu überlassen.
Im Organisationsausschuß (27. Sitzung) wurde jedoch von dem Abg. Dr. Katz (SPD) darauf hingewiesen, daß zumindest hinsichtlich des Bundespräsidenten eine Regelung sofort erfolgen müsse. Der Ausschuß beschloß dann eine Bestimmung folgenden Wortlauts:
Für die Wahl des ersten Bundespräsidenten stellt das Präsidium des Bundestages die Zahl der auf jedes Land entfallenden Mitglieder der Bundesversammlung fest und veranlaßt deren sofortige Wahl durch die Landtage.
Diese Bestimmung wurde vom Hauptausschuß in erster Lesung (20. Sitzung) gegen eine Stimme gutgeheißen. Die Notwendigkeit dieser Bestimmung wurde damit begründet, daß die Wahl des Bundespräsidenten in den ersten Tagen notwendig sei, aber bis dahin die vorgesehenen Gesetze über seine Wahl noch nicht vorlegen könnten. Deshalb müßten Ersatzwahlverfahren und Feststellungsverfahren im Grundgesetz vorgesehen werden.
Der Redaktionsausschuß wies darauf hin, daß diese Regelung unzureichend sei. Es müsse festgelegt werden, welches System der Verhältniswahl angewandt werden solle, ob das Stärkeverhältnis der Fraktionen oder der Parteigruppen in einem Lande maßgebend sein solle, ob die letzte Landtagswahl oder die Wahl des Bundestages zugrunde zu legen sei usw. Diese und andere Fragen müßten gesetzlich geregelt werden. Die Regelung erfolge am zweckmäßigsten zugleich mit dem Wahlgesetz für den ersten Bundestag. Sein Vorschlag ging dahin:
Für die Wahl des ersten Bundestages und der ersten Bundesversammlung…..gilt das diesem Grundgesetz beigefügte Wahlgesetz.
Dem Vorschlag traten der Organisationsausschuß (31. Sitzung) sowie der Hauptausschuß in seiner zweiten Lesung (40. Sitzung) bei. Der Vorsitzende des Hauptausschusses stellte auf einen Einwurf des Abg. Dr. Becker (FDP) klar, ein derartiges Wahlgesetz könne vom Bundestag jederzeit durch einfaches Bundesgesetz verlängert bzw. unter Umständen als zweites Wahlgesetz gleichlautend erlassen werden.
Auf Vorschlag des Fünfer-Ausschusses wurde die Wahl des ersten Bundespräsidenten in die Bestimmung mit einbezogen. Sie erhielt ihre endgültige Fassung in der dritten Lesung des Plenums, indem auf Antrag des Abg. Zinn (SPD) die Formulierung Zustimmung fand:
…..das vom Parlamentarischen Rat zu beschließende Wahlgesetz.
Artikel 137 Absatz 3 (Vorläufige Einschaltung des Deutschen Obergerichts in das Wahlprüfungsverfahren):
Das, wie erwähnt, durch die Proklamation Nr. 8 bzw. Verordnung Nr. 127 geschaffene Deutsche Obergericht für das Vereinigte Wirtschaftsgebiet übt neben seinen anderen Funktionen auch solche staats- bzw. verfassungsgerichtlicher Art aus, z. B. in Fällen, wo die Gesetzgebungskompetenz eines Landes im Hinblick auf die der Verwaltung für das Vereinigte Wirtschaftsgebiet zustehenden Befugnisse durch eine Klage der Verwaltung gegen das betreffende Land bestritten wird. Im Hinblick darauf erschien es dem Redaktionsausschuß zweckmäßig (Vorschlag vom 18.11.1948) nicht nur die Wahlprüfungsfunktionen, sondern generell die Funktionen des Bundesverfassungsgerichts übergangsweise vom Obergericht ausüben zu lassen. Diesem Vorschlag schlossen sich der Organisations ausschuß (27. Sitzung) sowie der Hauptausschuß in erster Lesung (20. Sitzung) an.
Es konnte jedoch die besondere Prägung, die dieses Gericht durch seine besatzungsrechtliche Organisationsgrundlage erfahren hat, und insbesondere die eigenartige staatsrechtliche Stellung dieser Institution, die unter Umständen nicht in allen Stücken als deutschem staatsrechtlichen Denken angemessen angesehen werden konnte, nicht völlig außer Acht gelassen werden. Deshalb entschloß sich der Redaktionsausschuß in seinem späteren Vorschlag (vom 18.12.1948) dazu, von bundesverfassungswegen die -vorläufige -Einschaltung des Obergerichts auf den Fall des Wahlprüfungsverfahrens zu beschränken und ihm lediglich die Entscheidung über Beschwerden gegen Entscheidungen des Bundestages in Wahlprüfungssachen bis zur Bildung des Bundesverfassungsgerichts zu übertragen.
Diese Lösung fand die Zustimmung des Organisationsausschusses (31. Sitzung) sowie des Hauptausschusses in zweiter Lesung (40. Sitzung) und erfuhr später lediglich eine textliche Aenderung durch Einfügung des Wortes „Deutsche“ (gemäß einer Anregung des Redaktionsausschusses vom 25.1.1949).
Die Vorschrift bildete zunächst einen selbständigen Artikel und wurde erst in der vierten Lesung des Hauptausschusses (57. Sitzung) auf Antrag des Abg. Zinn (SPD) als besonderer Absatz mit dem jetzigen zweiten Absatz, und in der dritten Lesung des Plenums mit dem jetzigen Absatz 1 zu einem Artikel vereint.
Die Verfahrensordnung, nach deren Maßgabe das Deutsche Obergericht zu entscheiden hat, ist am 8. April 1949 erlassen worden.
Wirksamwerden des Grundgesetzes:
Artikel 144 (Annahme des Grundgesetzes):
Der Herrenchiemseer Entwurf hatte für den Artikel 148 Absatz 2 eine Alternativ-Fassung folgender Form vorgeschlagen:
Das Deutsche Volk hat dieses Grundgesetz
a. durch Volksbeschluß in den Ländern
b. durch übereinstimmenden Beschluß der Volksvertretungen
als gemeindeutsches Recht angenommen. Es ist mit dem…..als rechtsverbindliches Gesetz im Sinne der Landesverfassungen in Kraft getreten.
Der Redaktionsausschuß hob (Vorsch!ag vom 24.11.1948) die Notwendigkeit einer Vorschrift betreffend die Annahme des Grundgesetzes hervor; der nähere Inhalt sei aber abhängig von der noch ausstehenden Vereinbarung der Militär-Gouverneure.
In der 27. Sitzung des Organisationsausschusses wies der Abg. Dr. Dehler (FDP) darauf hin, die die Feststellung der Annahme des Grundgesetzes treffende Stelle müsse eine entsprechende gesetzliche Grundlage haben, ohne sich auf die Londoner Dokumente stützen zu müssen. Der Organisationsausschuß gelangte zu folgender Fassung:
Das Grundgesetz bedarf der Annahme durch Volksentscheid in mindestens zwei Drittel der beteiligten Länder. In jedem Lande entscheidet die Mehrheit der Abstimmenden
Gemäß diesem Vorschlage wurde diese Bestimmung vom Hauptausschuß in erster Lesung (20. Sitzung) angenommen, dagegen in der zweiten Lesung (40. Sitzung) die Beschlußfassung zurückgestellt.
In der 32. Sitzung des Organisationsausschusses beantragte der Abg. Dr. Katz (SPD), die Vorschrift wie folgt zu fassen:
Dieses Gesetz bedarf der Annahme durch die Landtage in mindestens zwei Drittel der beteiligten Länder. In jedem Landtage entscheidet die einfache Mehrheit der Abgeordneten.
Der Abg. Dr. Katz (SPD) erklärte, es müsse genügen, daß das Grundgesetz durch die Landtage angenommen werde, ein Volksentscheid-Verfahren sei zu zeitraubend. Zu Ueberlegen sei, ob man evtl. den Ländern freistellen solle, das Grundgesetz statt durch ihr Landesparlament durch Volksentscheid annehmen zu lassen. Der Abg. Dr. Becker (FDP) sprach sich aus allgemein demokratischen Erwägungen dafür aus, es bei der ursprünglichen Fassung zu belassen. Von dem Abg. Dr. Löwenthal (SPD) wurde darauf hingewiesen, daß eine Alternativ-Lösung, die den Ländern die Entscheidung über die Art der Annahme überlassen, nicht angängig sei. Von den Abg. Dr. Schwalber (CSU) und Dr. Fecht (CDU) wurde betont, daß nach den süddeutschen Länderverfassungen eine Annahme durch einfaches Parlamentsgesetz nicht statthaft und schon deshalb ein Volksentscheid erforderlich sei.
Ein Mehrheitsbeschluß konnte nicht erzielt werden.
Die Frage „Annahme durch Volksentscheid oder durch die Landtage“ sollte nach Möglichkeit eine Klärung in interfraktionellen Beratungen erfahren. Deshalb kam es in der dritten Lesung des Hauptausschusses (51. Sitzung) zu keiner Beschlußfassung.
Ein neuer Vorschlag wurde vom Redaktionsausschuß für die vierte Lesung des Hauptausschusses durch Zufügen eines zweiten Absatzes gemacht, durch den den Ländern, in denen die Anwendung dieses Grundgesetzes einer Beschränkung unterliegt, ausdrücklich das Recht zuerkannt wurde, Vertreter in den Bundestag bzw. in den Bundesrat zu entsenden. Da es sich im Grunde um eine „Lex Berlin“ handelte, war in einer zweiten Variante keine allgemeine Fassung gewählt, sondern ausdrücklich auf Berlin abgestellt worden.
Der Artikel war Gegenstand eingehender interfraktioneller Besprechungen vor der vierten Lesung des Hauptausschusses. Von dem Abg. Dr. von Brentano (CDU) wurde für eine Anzahl seiner Fraktionskollegen die Erklärung abgegeben, daß sie sich gegen die vorgesehene Fassung des Absatz 1 aussprechen würden, sie der Meinung seien, daß das Grundgesetz unter allen Umständen einer Volksabstimmung unterworfen werden müsse; es sei eine unumgängliche Konsequenz demokratischer Auffassung, ein Grundgesetz, das sich schon in seiner Präambel auf die Gewalt des Volkes berufe, auch wirklich dem Volke zur Entscheidung vorzulegen. Von anderer Seite wurde demgegenüber insbesondere auf die Gefahr eines erheblichen Zeitverlustes hingewiesen, von dem Abg. Dr. Hoepker-Aschoff (FDP) außerdem darauf, daß von den Militär-Gouverneuren bereits gesagt worden sei, daß die Genehmigung durch die Landtage in Aussicht genommen sei. Der Abg. Dr. Katz (SPD) befürchtete, daß durch Anordnung eines Volksentscheides den negativen Kreisen des Volkes eine Kristallisationsmöglichkeit gegeben sein könne. Nach Ansicht des Abg. Dr. Süsterhenn (CDU) seien in der schwierigen derzeitigen politischen Situation die Landtage eher in der Lage, ein gewisses Entgegenkommen im Sinne eines Kompromisses zu finden.
In der vierten Lesung lehnte der Hauptausschuß (57. Sitzung) den Antrag des Abg. Dr. von Brentano (CDU) ab:
Die Annahme dieses Grundgesetzes wird durch Volksabstimmung entscheiden. Es gilt als angenommen, wenn die Wahlberechtigten sich mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen für die Annahme aussprechen.
Dagegen wurde der Vorschlag des Redaktionsausschusses, einschließlich der ersten Variante für den zweiten Absatz, angenommen.
In der zweiten Lesung des Plenums wies der Abg. Dr. von Brentano (CDU) nochmals darauf hin, da festgelegt sei, daß die Staatsgewalt vom Volke ausgeht, sei damit ein unverzichtbares, aber auch unabdingbares Recht des Volkes anerkannt; nur die Gesamtheit des Volkes könne die Verfassung mit dem erforderlichen Vertrauen ausstatten und sie damit zu lebendiger Wirksamkeit bringen, die für eine gesunde Entwicklung unserer Demokratie Voraussetzung sei. Der Abg. Dr. Becker (FDP) unterstützte den Antrag unter besonderem Hinweis darauf, daß unter Umständen nach der Verfassung des einen oder anderen Landes in dem betreffenden Lande eine Volksabstimmung stattfinden müsse. Der Antrag verfiel indes wiederum der Ablehnung. Vorher war ein Antrag des Abg. Renner (KPD) abgelehnt worden, der einen Volksentscheid in der Gestalt verlangte, daß die Zustimmung der Mehrheit aller Abstimmungsberechtigten erforderlich sei.
In der 3. Lesung des Plenums stellte der Abg. Dr. von Brentano (CDU) den gleichen Antrag -mit einer kleinen sprachlichen Verbesserung -nochmals, zusammen mit dem Abg. Dr. Dehler (FDP). Letzterer machte geltend, daß dem Vernehmen nach unter Umständen in Bayern eine Abstimmung durch das Volk in Aussicht genommen sei; es gehe aber nicht an, daß etwa in Bayern das Volk und in anderen Ländern jeweils der Landtag über eine wesentliche Frage des deutschen Schicksals entscheide. Der Abg. Dr. Schmid (SPD) vertrat gegenüber den Ausführungen der Abgeordneten Dr. von Brentano (CDU) und Dr. Dehler (FDP) den Standpunkt, das Grundgesetz sei seiner Rechtsnatur nach gar keine „Verfassung“, sondern lediglich ein Provisorium: „Wir haben hier doch nur einen Schuppen, und einem Notbau gibt man nicht die Weihe, die einem festen Hause gebührt“.
Bezüglich Berlins wurde von den Militär-Gouverneuren mit Schreiben vom 5.12.1949 erklärt, „daß Berlin keine abstimmungsberechtigte Mitgliedschaft im Bundestag oder Bundesrat erhalten und auch nicht durch den Bund regiert werden wird, daß es jedoch eine beschränkte Anzahl Vertreter zur Teilnahme an den Sitzungen dieser gesetzgebenden Körperschaften benennen darf“. Entsprechend der Anregung der Militär-Gouverneure wurde durch § 26 des Wahlgesetzes die Anzahl der Berliner Vertreter für den Bundestag auf acht beschränkt.
Artikel 145 (Feststellung der Annahme des Grundgesetzes, seine Ausfertigung und Verkündung):
Der Organisationsausschuß hatte in seiner 18. Sitzung einen Vorschlag des Abg. Dr. Katz (SPD) folgenden Inhalts angenommen:
Die Verkündung…..erfolgt durch die Ministerpräsidenten der Länder Baden usw. nach seinem Inkrafttreten…..tritt mit dem Tage der Verkündung in Kraft.
Nach Auffassung des Redaktionsausschusess war indes diese Formulierung unzulänglich und widerspruchsvoll, da einerseits die Verkündung nach Inkrafttreten vorgenommen werden, andererseits jedoch das Inkrafttreten von der Verkündung abhängig sein sollte. Offengeblieben war auch, wie die Verkündung geschehen sollte, ob in einem neuen Gesetzblatt oder in den bestehenden 11 Gesetzblättern der Lähder oder in sonstigen Verkündungsblättern. Der Redaktionsausschuß glaubte, daß die nach deutscher Auffassung erforderliche öffentl. Verkündung zur Hervorhebung der Bedeutung dieses Aktes zweckmäßigerweise durch den Parlamentarischen Rat als die in diesem Zeitpunkt berufenste Vertretung des Volkes in seiner Gesamtheit vorgenommen werden sollte. Die Ausfertigung könne durch die Abgeordneten, nach dem Vorbild der Verfassung von 1849, erfolgen. Die Verkündung habe in öffentlicher Sitzung zu geschehen, dann komme der nachstehenden Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt lediglich deklaratorische Bedeutung zu.
In der 27. Sitzung des Organisationsausschusses wies gegenüber einem Einwurf des Abg. Walter (CDU), ob nicht zur Ausfertigung das Präsidium oder allenfalls die Hälfte der Mitglieder des Parlamentarischen Rates genügten, der Abg. Zimmermann (SPD) auf das Vorbild der amerikanischen Verfassung hin, die von allen Abgeordneten unterzeichnet worden sei.
Der vom Redaktionsausschuß gemachte Vorschlag wurde vom Hauptausschuß in allen Lesungen gebilligt. In der zweiten Lesung (40. Sitzung) des Hauptausschusses schlug der Abg. Dr. Becker (FDP) eine Verkündung in den Gesetzblättern der einzelnen Länder vor, da ein Bundesgesetzblatt in dem fraglichen Zeitpunkt noch nicht vorhanden sei. Der Abg. Zinn (SPD) wies jedoch darauf hin, daß die eigentliche Verkündung mit der Wirkung des Inkrafttretens nach der vorgeschlagenen Fassung nicht durch die Veröffentlichung in einem Gesetzblatt, sondern durch die „Verkündung“ durch den Parlamentarischen Rat erfolge. Die Veröffentlichung habe keine andere Bedeutung, als daß der Text im Gesetzblatt irgendwann einmal festgehalten werde, das aber könne nachgeholt werden. Der Bevölkerung werde der Text natürlich sofort durch die Presse bekanntgegeben werden. Auch brauchten nicht etwa alle Artikel vorgelesen zu werden.
Erleichterte Möglichkeit einer Revision sowie Außerkrafftreten des Grundgesetzes:
Erleichterte Revisionsmöglichkeit?
Für eine Revision des Grundgesetzes sind in Artikel 79 ganz bestimmte erschwerende Voraussetzungen aufgestellt; außerdem: sind gewisse Verfassungsänderungen überhaupt unzulässig.
In den interfraktionellen Besprechungen vor der vierten Lesung des Hauptausschusses regte der Abg. Dr. Heuß (FDP) die Aufnahme einer Bestimmung folgenden Inhalts im Abschnitt „Schluß- und Uebergangsbestimmungen“ an: Nach Ablauf von drei Jahren seit dem Inkrafttreten kann das Grundgesetz binnen einer Frist von zwei Jahren durch ein Bundesgesetz geändert werden das der Zustimmung des Bundesrates bedarf.
Danach könne also eine solche Aenderung, wenn sie sich im Laufe der Zeit auf Grund der gemachten Erfahrungen als notwendig erwiesen habe, im Wege der einfachen Bundesgesetzgebung erfolgen. Der Abg. Dr. Heuß (FDP) erläuterte seine Anregung vor allem mit dem Hinweis darauf, daß im Verlauf von drei Jahren das Grundgesetz seine Schwierigkeiten aufweisen werde, und daß man dann, ohne den ganzen komplizierten Apparat einer Verfassungsänderung in Bewegung setzen zu müssen, zu einer Bereinigung dieser Schwierigkeiten kommen könnte. Der Abg. Dr. Schmid (SPD) erklärte sich im Prinzip mit einer solchen Revisionsmöglichkeit einverstanden, glaubte aber, daß man doch die Zustimmung eines gewissen Prozentsatzes der Landtage vorsehen müsse. Dazu verwies der Abg. Zinn (SPD) auf einen Vorschlag seiner Fraktion, nach dem die Zustimmung von zwei Dritteln der Volksvertretungen der Länder vorgesehen sei. Damit werde bei einer beabsichtigten Aenderung der Verfassung der gleiche Weg gegangen, der bei ihrer Annahme eingeschlagen werde. Es sei vollkommen ausgeschlossen, daß wirklich umstrittene Dinge auf diesem Wege geändert würden, aber eine sachliche Beschränkung auf wesentliche Dinge sei praktisch nicht möglich. Der Abg. Dr. von Brentano (CDU) war der Ansicht, daß eine solche Bestimmung den Charakter des zu schaffenden Gesetzeswerkes grundlegend ändern werde. Es werde dann keine Verfassung mehr geschaffen, sondern nur ein Gesetz, das auf Zeit mit erschwerten Abänderungsbedingungen umkleidet sei. Es handele sich hierbei um eine ganz grundsätzliche Frage, die eine völlig neue Situation schaffe. Es liege im Wesen einer Verfassung, daß sie der nachfolgenden Zeit eine Bindung auferlege. Die Aufnahme der vorgeschlagenen Bestimmung würde den Charakter des Grundgesetzes ändern und eine sachliche Arbeit im Parlament unmöglich machen. Demgegenüber war der Abg. Dr. Hoepker-Aschoff (FDP) der Auffassung, daß durch eine derartige Bestirnmung die Verfassung ihren Charakter als Verfassung nicht verliere. Es sei nicht etwa so, daß der Gesetzgeber sich bei jedem Gesetz über die Verfassung hinwegsetzen könnte, weil die Verfassung durch einfaches Bundesgesetz abänderbar sei. Der Verfassungscharakter bleibe erhalten. Der Abg. Dr. Menzel (SPD) erinnerte daran, daß der Parlamentarische Rat bei Beginn seiner Arbeiten von der Vorläufigkeit des Grundgesetzes ausgegangen sei. Im Einverständnis mit den Ministerpräsidenten sei das zu schaffende Werk auch nicht als Verfassung bezeichnet worden. Präsident Dr. Adenauer hielt insbesondere die vorgeschlagene allgemeine Formulierung für bedenklich; die dadurch hervorgerufene Unsicherheit könne größer sein als die vielleicht zu erzielenden Vorteile. Auch der Abg. Kaufmann (CDU) hielt den in dem Heuß’schen Vorschlag aufgezeigten Weg nicht für gangbar: Nach diesem Vorschlag wäre es denkbar, daß der nächste, auf vier Jahre gewählte Bundestag beschließe, den nächstfolgenden Bundestag als verfassungsgebende Versammlung wählen zu lassen. Das würde bedeuten, daß dann dieser Bundestag alle Beschlüsse mit einfacher Mehrheit fassen könnte. Von dem Abg. Dr. von Mangoldt (CDU) wurde die erschwerte Abänderbarkeit als eines der Hauptmerkmale jeder Verfassung bezeichnet. Der Abg. Dr. Laforet (CSU) betonte, daß das vorliegende Gesetz als Grundgesetz gedacht und wie eine Verfassung behandelt worden sei. Man habe ausdrücklich Verfassungsänderungen vorgesehen und das ganze Rüstzeug der Rechtswissenschaft gerade in diesem Punkt zur Verfügung gestellt. Es sei in der ganzen Rechtsentwicklung so, daß Gesetze dieser Art Festlegungen auch für eine spätere Zeit träfen, in der die Zusammensetzung des Gesetzgebungsorgans sich geändert habe. Aenderungen seien selbstverständlich möglich, aber sie müßten im Wege der Verfasssungsänderung erfolgen; die jetzt vorgeschlagene Regelung sei ein Bruch in der ganzen Rechtsauffassung. Der Abg. Dr. Süsterhenn (CDU) sah einen besonderen Gefahrenpunkt darin, daß bei Annahme der vorgeschlagenen Bestimmung eine große Partei zusammen mit einer kleineren Partei in die Lage versetzt werde, die Dinge zu ändern. Gegen die SPD könne sich das auf dem wirtschaftlichen und sozialen Sektor, gegen die CDU/CSU auf dem förderalistischen oder kulturellen Sektor konkretisieren.
In der vierten Lesung des Hauplausschusses (57. Sitzung) wurde der angekündigte Antrag von dem Abg. Dr. Heuß (FDP) in folgender Form gestellt:
Nach Ablauf von drei Jahren seit seinem Inkrafttreten kann das Grundgesetz binnen einer Frist von zwei Jahren durch ein Bundesgesetz geändert werden, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf. Die Artikel 20 c, 21, 106 -alte Fassung -bleiben unberührt.
Er verfiel indes gegen die Stimme des Antragstellers der Ablehnung. Abgelehnt wurde weiterhin, und zwar mit neun gegen sieben Stimmen, folgender Antrag des Abg. Dr. Greve (SPD):
Nach Ablauf von zwei Jahren nach seinem Inkrafttreten kann das Grundgesetz binnen Jahresfrist durch einfaches Bundesgesetz geändert werden. Artikel 21 und 106 -alte Fassung -bleiben unberührt. Das Gesetz bedarf der Zustimmung der Volksvertretungen von mindestens zwei Dritteln der Länder.
Schließlich wurde, mit zehn gegen fünf Stimmen, auch ein Antrag des Abg. Brockmann (Z) abgelehnt:
Binnen Jahresfrist nach Inkrafttreten des Grundgesetzes kann der Bundestag in Uebereinstimmung mit dem Bundesrat die Grundrechte ergänzen, aber nicht beschränken.
In diesem Zusammenhang sei noch bemerkt: In seiner -ersten bzw. zweiten -Lesung hatte der Hauptausschuß, auf Vorschlag des Redaktionsausschusses 2 Artikel folgenden Wortlauts beschlossen:
Artikel 148 a (alte Fassung)
Die Verfassung eines Landes kann binnen zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Grundgesetzes zur Angleichung an das Grundgesetz durch einfaches Landesgesetz geändert werden. Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Bund und Ländern entscheidet das Bundesverfassungsgericht.
Artikel 148 b (alte Fassung)
Vorschriften einer Landesverfassung, die über die Vorschriften dieses Grundgesetzes hinaus das Wahlverfahren und die Art des Wahlrechts regeln, können jederzeit durch einfaches Landesgesetz geändert werden.
Vor allem die Ueberzeugung, daß dadurch unter Umständen unnötigen bzw. allzu weitgehenden Eingriffen in die Substanz der Landesverfassungen Vorschub geleistet und die unumgänglich notwendige Achtung vor den jeweiligen Landesverfassungen beeinträchtigt werden könnte, veranlaßte jedoch den Hauptausschuß in seiner dritten Lesung, diese Bestimmungen wieder zu streichen.
Artikel 146 (Außerkrafttreten des Grundgesetzes):
Der Artikel 149 des Herrenchiemseer Entwurfes lautete:
Dieses Grundgesetz verliert seine Geltung an dem Tage, an dem eine von dem deutschen Volke in freier Selbstbestimmung beschlossene Verfassung in Kraft tritt.
In einer zweiten Variante war diese Bestimmung jedoch nicht vorgesehen und zwar aus dem Grunde, weil nach Auffassung eines Teiles des Verfassungskonventes die künftige freie Entscheidung über das Außerkrafttreten des Grundgesetzes sich nach den vom Grundgesetz selbst für seine Abänderung gegebenen Bestimmungen vollziehen müsse. Ein Artikel des vorgesehenen Wortlauts könne stattdessen eine Legalisierung beliebiger anderweitiger Akte bedeuten, die etwa nach Herstellung der außenpolitischen Freiheit unter dem Titel einer freien Konstituierung Deutschlands vorgenommen werden sollten.
Der Organisationsausschuß übernahm indes in seiner 18. Sitzung den Herrenchiemseer Vorschlag unter Einfügung des Wortes „ganzen“ vor „deutschen Volke“.
Der Redaktionsausschuß wollte (Vorschlag vom 24.11.1948) die Bestimmung wie folgt fassen:
Dieses Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von einer frei gewählten und frei entscheidenden gesamtdeutschen Nationalversammlung beschlossen worden ist.
Auch der Redaktionsausschuß wies darauf hin, daß gewisse Bedenken in der vom Herrenchiemseer Konvent zum Ausdruck gekommenen Richtung bestünden; andererseits aber habe der Artikel einen bedeutsamen Rechtsinhalt, nämlich die Aufhebung der Erschwernisse einer Verfassungsänderung in dem hier vorgesehenen Fall.
Der Hauptausschuß schloß sich in erster Lesung (20. Sitzung) dem Vorschlag des Redaktionsausschusses an. Dabei wurde von dem Vorsitzenden, Dr. Schmid (SPD), hervorgehoben, die Bestimmung stelle völlig klar, daß die endgültige deutsche Verfassung nicht im Wege der Abänderung dieses Grundgesetzes entstehen werde, sondern originär.
In der 27. Sitzung des Organisationsausschusses trat der Abg. Dr. Dehler (FDP) für eine Streichung ein. Es bestehe die Gefahr, daß eine Mehrheit sagen könne: jetzt sind wir eine freie volksdemokratische Gemeinschaft. Der Abg. Dr. Katz (SPD) bemerkte, wenn der Vorschrift auch keine rechtskonstitutive Wirkung zukomme, so sei sie doch mindestens eine sehr schöne Deklamation.
Die endgültige Fassung des Artikels beruht auf einem Vorschlag des Redaktionsausschusses (vom 16. 12. 1948). Lediglich das zunächst vorgesehene Wort „gesamten“ vor „deutschem Volke“ wurde, entsprechend einer Anregung des Fünfer-Ausschusses, vom Hauptausschuß in seiner dritten Lesung (51. Sitzung) gestrichen.
Zum Hauptmenu der Rubrik Begründung des Grundgesetzes durch seine Verfasser